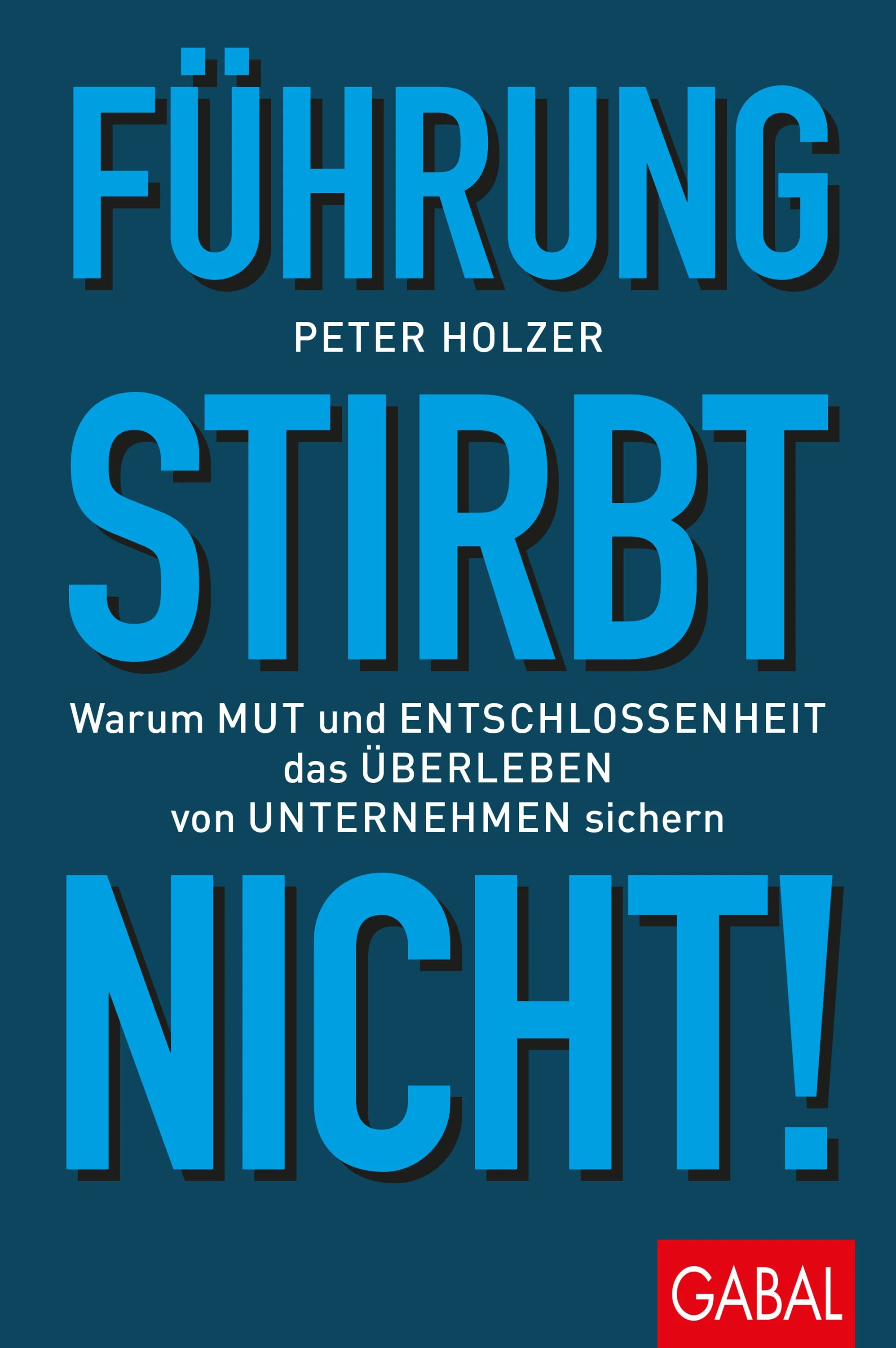Unternehmen sind infiziert vom Gemocht-werden-wollen-Virus
Unternehmen sind infiziert vom Gemocht-werden-wollen-Virus
Politiker beherrschen die hohe Kunst, Fragen zu beantworten, ohne konkrete Inhalte zu liefern. Das müssen sie auch: Denn Kameras halten jedes ihrer Wort fest. Und wenn nur ein «falsches» Wort dabei ist, fühlt sich sofort jemand diskriminiert und der gesellschaftliche, dauer-erregte Mob ist «entsetzt». Schnell droht ein Shitstorm, den guten Ruf und damit die Wählergunst zu gefährden. Wer heikle Missstände kririsiert, Klartext redet, wird heutzutage viel zu schnell schnell geächtet und in radikale Ecken gepresst.
Ähnlich bizarr geht es mittlerweile in einigen Unternehmen zu. Zwar laufen überall bunte Kampagnen mit Bekennungen zu Diversity. Doch ich bekomme immer wieder mit: Genau das verschärft die Sorge der Menschen, jemandem auf den Schlips zu treten. Was darf man sagen? Und wer entscheidet das überhaupt? Halten wir es miteinander noch aus, wenn wir unterschiedliche Standpunkte haben — oder verweigern wir dann jeden weiteren Kontakt?
Worte siNd nicht überall frei
Audi wollte durch ein internes Schriftstück mit dem Titel «Vorsprung beginnt im Kopf» besonders vorsichtig — oder respektvoll, progressiv, trendy? — sein. In dem Text wird den Mitarbeitern nahe gelegt, gendersensible Sprache zu verwenden. Aus Mitarbeitern werden «Audianer_innen», die Ansprache in Massenmails lautet «Mitarbeiter_in». Interne Arbeitsanweisungen beinhalten Formulierungen wie: «Der_die BSM-Expertin ist qualifizierte_r Fachexpert_in». Es scheint so, als wäre die Form auf einmal wichtiger als der Inhalt.
Um es auf den Punkt zu bringen: Ich bin für gleiche Rechte für alle. Punkt. Unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht und was es sonst noch so gibt. Und natürlich muss gleiche Arbeit (oder präziser: gleiche Leistung) auch gleich bezahlt werden. Alles andere wäre absurd. Aber all das ist kein Grund dafür, unsere Sprache unnötig zu verkomplizieren.
Ich habe mich deswegen für Pragmatismus entschieden: Texte in solchen, den Inhalt verkomplizierenden Schriftformen lese ich einfach nicht mehr. Von begeisterten Audi-Fans weiß ich, dass sie auf Grund dieses übergriffigen, sprachmoralisierenden Verhaltens schweren Herzens die Automarke gewechselt haben. Ein VW-Mitarbeiter zieht sogar gegen die Sprachvorgaben vor Gericht. Mutig von dem Herrn. Denn Mund aufmachen und Haltung zeigen sind eher selten ausgeprägte Verhaltensweisen in Unternehmen. Aber warum?
Sehnsucht nach Nestwärme
Eines haben wir alle gemeinsam: Das Bedürfnis, dazuzugehören. Das wurde uns während unserer 300.000 Jahre währenden Menschheitsgeschichte in die Gene gehämmert. Jeden Tag ging es um Leben und Tod. Nur wenn wir Mitglied eines Clans waren, hatten wir als Individuum eine Chance, in der Wildnis zu überleben. Anders formuliert: Wer aus dem Clan verstoßen wurde, stirbt.
Auch in der Wildnis der modernen Arbeitswelt spielt das Bedürfnis nach Zugehörigkeit immer noch eine große Rolle. Vielleicht wird es sogar immer wichtiger, da viele Menschen immer weniger Nestwärme in ihrem (privaten) Leben verspüren?
Familien zerbröseln zu kleinen Fragmenten. Manches Ehepaar gleicht eher Freunden, die im gleichen Haus wohnen. Selbst innerhalb der Kernfamilie kämpfen manche Väter und Mütter gegeneinander um Emanzipation, anstatt sich als Einheit zu verstehen. Wenn beide Eltern nach einem anspruchsvollen Arbeitstag abends erschöpft aufs Sofa fallen, ist weder Zeit noch Energie für die Kinder da. Zum Glück kann man sie mit der Playstation ruhig stellen — oder sie gleich zur Nanny oder ins Internat abschieben. Parallel wächst die Zahl der Single-Haushalte. Zwar scheinen viele das Single-Leben freiwillig und gerne zu wählen. Doch Fakt ist: Auf Dauer wartet abends nicht die gesellige Familie am Esstisch, sondern die einsame Kälte in der Wohnung.
Auch die Bedeutung von Religion und der Zusammenhalt in einer Glaubensgemeinschaft nehmen in unserer Gesellschaft zunehmend ab. Die Corona-Pandemie leistete dann durch das Verbot und die Vermeidung echter Begegnungen ihren Beitrag zur zunehmenden Entfremdung. Zwar sammelt man auf Facebook «Freunde»; doch auch wenn Sie davon Tausende haben, tragen diese noch lange nicht dazu bei, dass Sie sich zugehörig fühlen. Im Gegenteil: Teenager werden depressiv, wenn Sie ein paar Hundert weniger «Freunde» oder Likes bekommen als ihre Peer-Group. Nur der Fußball scheint nach wie vor als zweite Heimat immer noch zu funktionieren — und das Gefühl der Zugehörigkeit zu vermitteln ;-)
Wie viel Ehrlichkeit ist gewünscht?
Bei all diesen sozialen Strömungen ist es also nicht verwunderlich, dass für einige Menschen das berufliche Umfeld zur Ersatzfamilie geworden ist. Es wäre demnach «lebensgefährlich», aus diesem Clan verstoßen zu werden.
Zwar loben einige Menschen die offene Diskussionskultur in ihren Firmen. Doch hinter vorgehaltener Hand weiß jeder: Wenn Du das Falsche zur richtigen Person sagst, bekommst Du zwar mit einem netten Lächeln gesagt: «Vielen Dank für Ihre Meinung». Faktisch endet Deine Karriere trotzdem von nun an in einer Sackgasse. Diversity heißt eben noch lange nicht, dass auch wirklich alle Meinungen ausgehalten werden. Mal sehen, wie es für den Herrn ausgeht, der die Gendersprache bei Audi nicht mitmachen will.
Und so verbreitet sich — wider aller öffentlichen Bekundungen — in vielen Unternehmen immer noch das Gemocht-Werden-Wollen-Virus. Die Symptome: politisch korrekter Weichspüler, Wokeness, Cancel-Culture.
Gelebte Toleranz für vermeintliche Minderheiten reicht nicht mehr aus. Wenn Sie als Person im Unternehmen überleben wollen, müssen Sie jede Ausprägung von Individualität aktiv öffentlich unterstützen — und vor allem auch gut heißen.
Beispiel: In der Vergangenheit reichte es aus, wenn es Ihnen schlichtweg egal ist, welche sexuelle Orientierung Ihr Gegenüber hat — und Ihnen inhaltliche Zusammenarbeit wichtiger als die erotischen Vorlieben Ihrer Kollegen ist. Heute müssen Sie sich öffentlich bekennen: «Ich finde trans / schwul / … sein super.» — sofern Sie keine sozialen Sanktionen abbekommen wollen.
Akzeptanz ist für manche, die sich dem zwangsverordneten Umbauen unserer Gesellschaft verschrieben haben, einfach zu wenig. Aber soll verordnetes, missionarisches Zwangsbekenntnis der neue Standard werden? Alles für ein vermeintlich friedvolles, respektvolles Miteinander? In den Unternehmen erzählen die Menschen dann stolz von Ihrem Arbeitgeber: «Wir sind wie eine Familie». Ein gefährlicher Irrtum.
Unternehmen sind keine Familien, sondern Zweckgemeinschaften
Lassen Sie es mich klar formulieren: Unternehmen sind keine Familie. Es sind professionelle Zweckgemeinschaften mit dem Ziel, einen unternehmerischen Nutzen zu stiften. Heißt: Für Probleme Lösungen zu finden. Dazu entwickeln sie Produkte und Dienstleistungen, um damit Geld zu verdienen.
Nur weil einige Unternehmen die Sinn-Leere der Menschen versuchen zu füllen, indem sie einen «Purpose» versprechen, heißt nicht, dass das Unternehmen eine Familie für die Angestellten wird.
Der Grund ist einfach: Familienmitglieder können Sie nicht rausschmeißen. Mitarbeiter schon. Und das sollten Sie auch, wenn die Leistung auf Dauer nicht stimmt. Denn darauf kommt es am Ende des Tages an.
Arbeit ist eine Tätigkeit, mit der Sie für Ergebnisse sorgen. Punkt. Wer das auf Dauer nicht bringen kann, hat in dem Unternehmen nichts mehr verloren. Klingt hart. Ist aber so.
Was passiert dann, wenn Sie sich so sehr emotional an Ihre «Ersatz-Familie» klammern und das Unternehmen Ihnen kündigt? Dazu müssen Sie ja noch nicht mal Mist gebaut haben. Es reicht, wenn die Firma plötzlich eine wirtschaftlich schwere Zeit durchmacht. Dann verlieren Sie nicht nur Ihren Job, sondern zusätzlich Ihre gefühlte Familie. Emotional weiß jeder: Einen neuen Job kann man schnell finden. Eine neue Familie nicht so ohne Weiteres.
Trennen Sie Ihren persönlich-privaten Kern lieber von der beruflichen Welt. Natürlich können Sie in der Firma «familiär» miteinander umgehen. Sollten Sie vielleicht sogar. Aber halten Sie dennoch die notwendige Distanz und professionelle Nähe, um Klartext miteinander reden zu können.
Konflikte zwischen Menschen sind per se anspruchsvoll. Aus der Erfahrung mit vielen mittelständischen Familienunternehmen weiß ich, dass aus einem heiklen Terrain plötzlich eine «no-go Area» wird, sobald der Gegenüber nicht nur «jemand» ist, sondern «jemand aus der Familie». Wozu sollten Sie es sich also unnötig schwer machen, und Menschen als Familie bezeichnen, die einfach nur Kollegen sind?
Alles, was Sie nicht aussprechen, werden Sie ausleben
Ich denke, Streitkultur ist essenziell, wenn Sie Ihre Zukunftsfähigkeit sichern wollen. Denn wenn Sie die heiklen Themen nicht aussprechen, können Sie sie auch nicht lösen. Und noch viel schlimmer: Alles, was Sie nicht aussprechen, werden Sie ausleben.
Das Verhalten Ihrer Kollegin nervt Sie — aber Sie sprechen sie nicht darauf an? Schon bald werden Sie nicht mehr so hilfsbereit sein. Vielleicht schnippig reagieren, wenn sie etwas fragt. Oder gar in passiven Widerstand verfallen oder sie ins offene Messer laufen lassen, sobald sich eine intelligente Gelegenheit dazu ergibt.
Merken Sie sich: Sie können Personalthemen nicht aussitzen. Sie müssen Sie anpacken und zur Lösung treiben. Sonst verselbstständigt sich die negative Energie. Kein guter Plan.
Meinung sagen heißt: Streitkultur
Am besten fangen Sie gar nicht erst an, in das weichgespülte Geschwurbel des aktuellen Zeitgeists einzustimmen. Entscheiden Sie sich lieber für: hart in der Sache, fair zum Menschen.
Diskutieren, debattieren, austauschen — alles die falschen Begriffe. Lernen Sie, mit den Menschen in Ihrem Umfeld zu streiten.
Sie werden erleben: Die meisten Menschen verbinden mit Streit etwas Negatives. In der Folge wollen sie sich auch gar nicht streiten. Doch das ist falsch. Denn ein Streit ist nichts anderes als eine offen ausgetragene Meinungsverschiedenheit.
Wenn Ihnen «Streit» zu hart ist, nennen Sie es von mir aus Streit-Kultur. Kultur beinhaltet, dass der Streit nach gewissen Spielregeln abläuft. Für mich gehört dazu die oben genannte Essenz: Hart in der Sache, fair zum Menschen.
Manche meiner Kunden machen dann daraus vorsichtig eine respektvolle Streitkultur. Daran sehen Sie: Wir haben noch viel zu lernen auf unserem Weg in eine gute zwischenmenschliche — und gleichzeitig leistungsorientierte Zukunft der Arbeit. Am besten fangen wir dazu mit den Basics an: Weniger empfindlich werden — und gleichzeitig empfindsam bleiben.
IHNEN HAT DER TEXT GEFALLEN?
Weitere gedankliche Reibungsfläche finden Sie in meinem Buch «Führung stirbt nicht».
Oder abonnieren Sie meinen Newsletter «Holzer‘s Horizonte». Hier sende ich Ihnen ca. 6x im Jahr Artikel, Videos und Audio-Beiträge rund um Führung, Mut und Lebens-Führung zu.