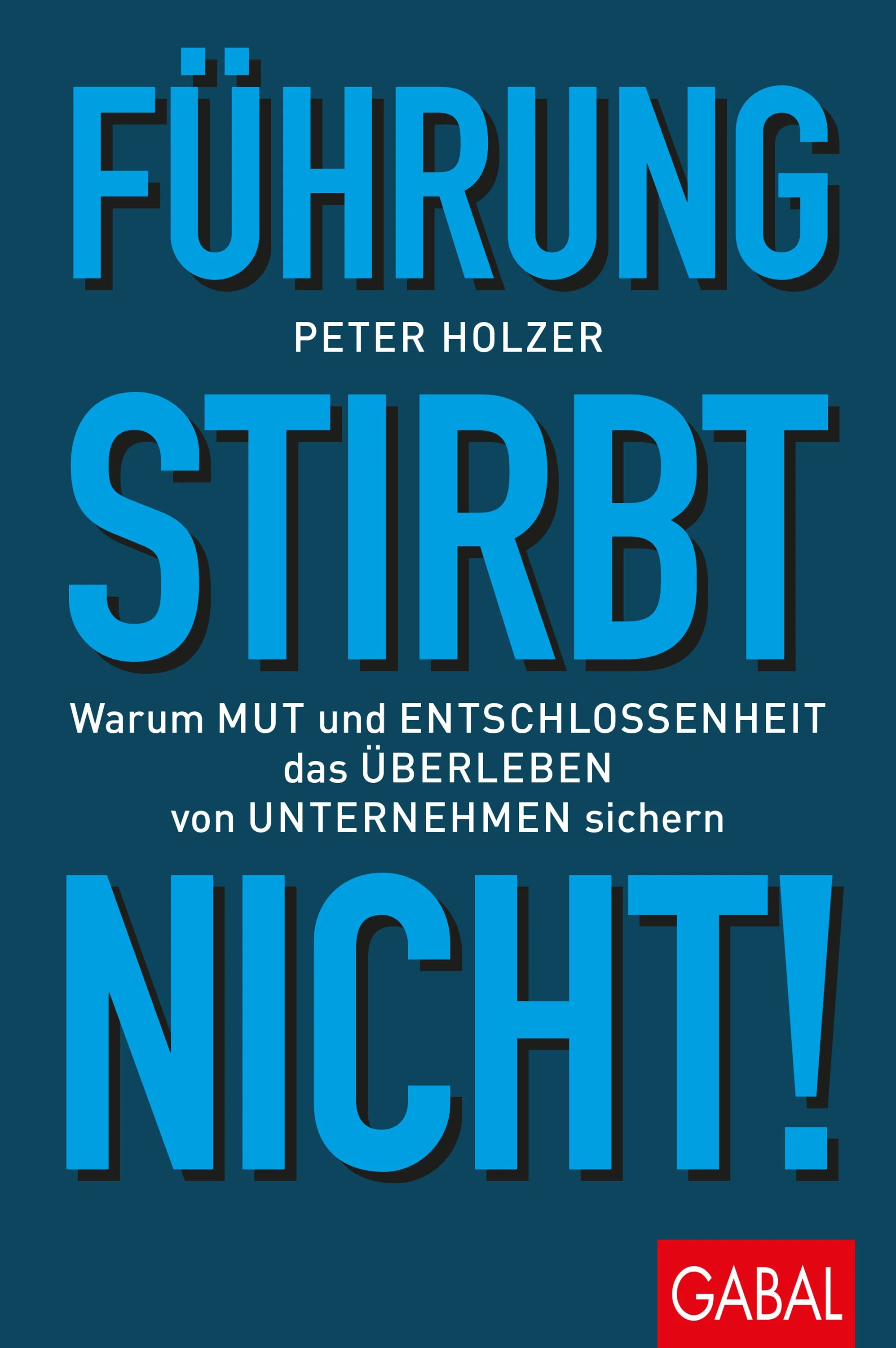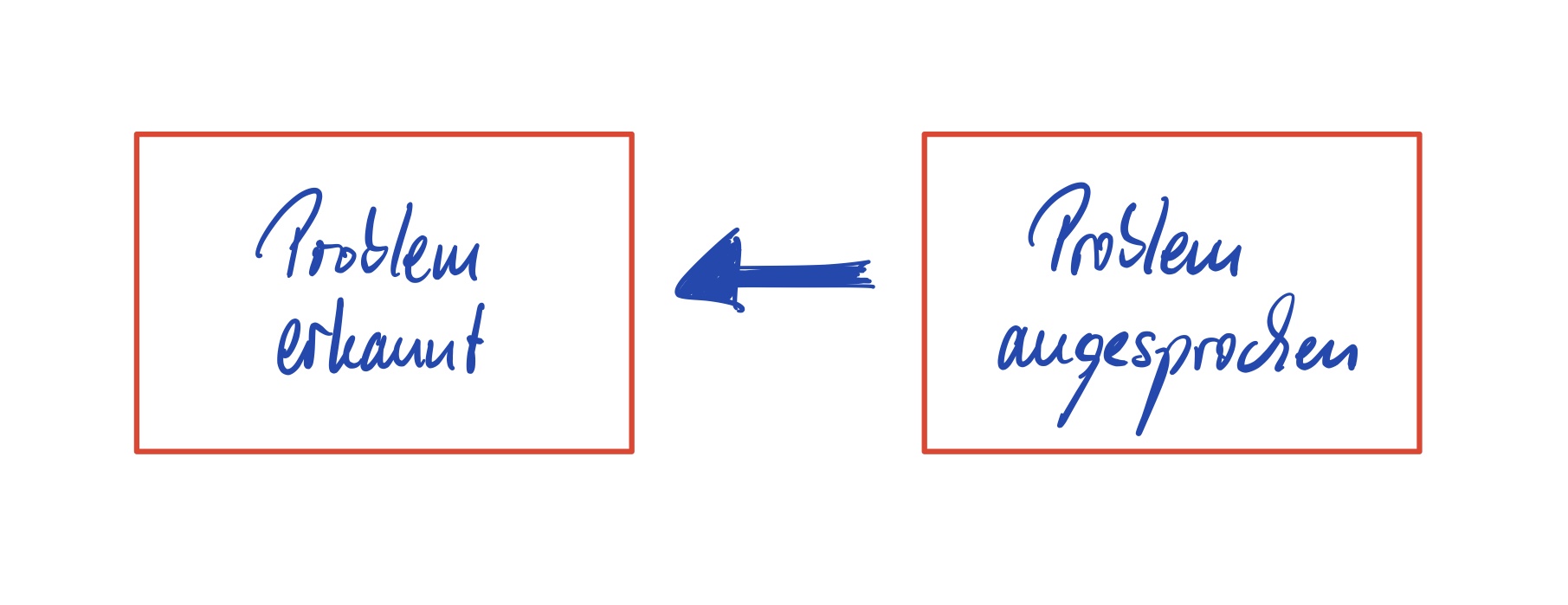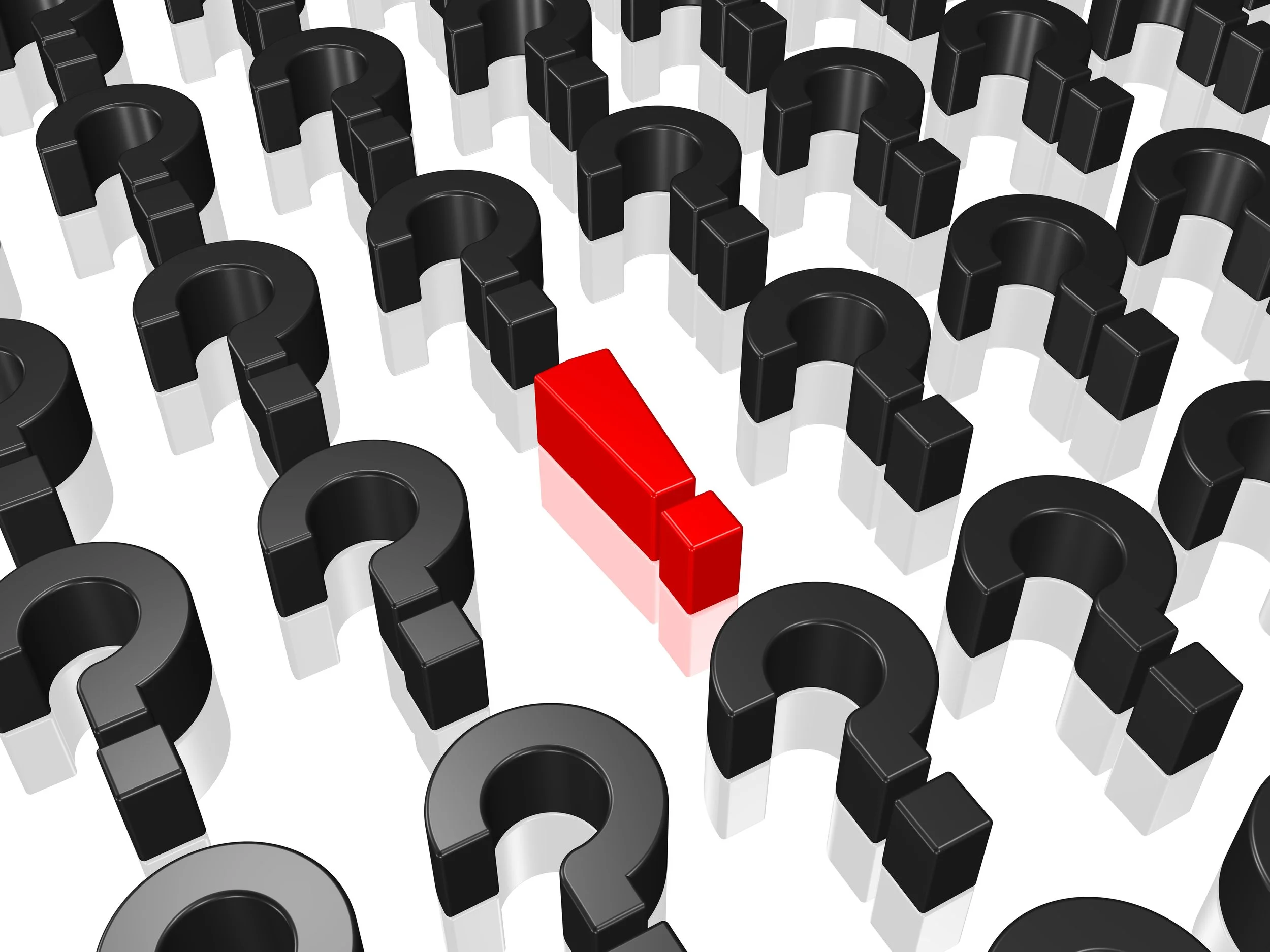HOLZERS HORIZONTE
Raus aus dem Mittelmaß
In vielen Unternehmen scheint sich zunehmend die Haltung zu verbreiten, dass Arbeit etwas Unangenehmes ist. Etwas das anstrengend ist und was man idealerweise zurückfahren sollte. Das stimmt ja auch im Grundsatz. Doch wenn die Konsequenz daraus ist, dass wir als Land weiter ins Mittelmaß der Bequemlichkeit rutschen, dann wird es gefährlich. Uns droht, im globalen Wettbewerb abgehangen zu werden. Wie können wir dies vermeiden?
Raus aus dem Mittelmaß
In vielen Unternehmen scheint sich zunehmend die Haltung zu verbreiten, dass Arbeit etwas Unangenehmes ist. Etwas das anstrengend ist und was man idealerweise zurückfahren sollte. Irgendwie auch verständlich, denn unser Leben ist endlich. Warum also Malochen wie ein Berserker?
Doch die Anspruchshaltung, nur noch 30 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich zu arbeiten, ist dekadent. Dekadent im Sinne von selbstgefällig. Und sie ist sogar gefährlich. Denn sie gefährdet unseren Wohlstand.
Die Gefahr ist, dass unsere Produktivität sinkt. Dass wir unsere wirtschaftlich und technologisch führende Rolle in der Welt verlieren. Oder wir gar im internationalen Wettbewerb völlig den Anschluss verlieren. Der Preis dieser Entwicklung wäre fatal: steigende Arbeitslosigkeit, sinkende Steuereinnahmen, kollabierender Sozialstaat. Ein Weg in Richtung Armut.
Leider ist in unserer Gesellschaft die Bequemlichkeit des Mittelmaßes zur Normalität geworden. Wir sollten uns als Gesellschaft fragen:
Was ist uns wirklich wichtig?
Gehört Wohlstand dazu?
Wo ist unser Streben nach Exzellenz geblieben?
Es wird Zeit für eine mentale Kehrtwende!
Lesen Sie den ganzen Artikel, der im Original als Gastbeitrag im Magazin “FiNet E-Worker” erschienen ist, hier: PDF-Download.
Unternehmen sind infiziert vom Gemocht-werden-wollen-Virus
Zwar laufen überall in den Unternehmen bunte Kampagnen mit Bekennungen zu Diversity. Doch ich bekomme immer wieder mit: Genau das verschärft die Sorge, etwas “falsch” zu machen. Statt echter Streitkultur - hart in der Sache, fair zum Menschen - breitet sich nach wie vor der Gemocht-Werden-Wollen-Virus aus. Es wird Zeit, das versteckte Potenzial zu heben. Vor allen Dingen mit Blick auf die großen Herausforderungen, die auf uns zukommen.
Unternehmen sind infiziert vom Gemocht-werden-wollen-Virus
Politiker beherrschen die hohe Kunst, Fragen zu beantworten, ohne konkrete Inhalte zu liefern. Das müssen sie auch: Denn Kameras halten jedes ihrer Wort fest. Und wenn nur ein «falsches» Wort dabei ist, fühlt sich sofort jemand diskriminiert und der gesellschaftliche, dauer-erregte Mob ist «entsetzt». Schnell droht ein Shitstorm, den guten Ruf und damit die Wählergunst zu gefährden. Wer heikle Missstände kririsiert, Klartext redet, wird heutzutage viel zu schnell schnell geächtet und in radikale Ecken gepresst.
Ähnlich bizarr geht es mittlerweile in einigen Unternehmen zu. Zwar laufen überall bunte Kampagnen mit Bekennungen zu Diversity. Doch ich bekomme immer wieder mit: Genau das verschärft die Sorge der Menschen, jemandem auf den Schlips zu treten. Was darf man sagen? Und wer entscheidet das überhaupt? Halten wir es miteinander noch aus, wenn wir unterschiedliche Standpunkte haben — oder verweigern wir dann jeden weiteren Kontakt?
Worte siNd nicht überall frei
Audi wollte durch ein internes Schriftstück mit dem Titel «Vorsprung beginnt im Kopf» besonders vorsichtig — oder respektvoll, progressiv, trendy? — sein. In dem Text wird den Mitarbeitern nahe gelegt, gendersensible Sprache zu verwenden. Aus Mitarbeitern werden «Audianer_innen», die Ansprache in Massenmails lautet «Mitarbeiter_in». Interne Arbeitsanweisungen beinhalten Formulierungen wie: «Der_die BSM-Expertin ist qualifizierte_r Fachexpert_in». Es scheint so, als wäre die Form auf einmal wichtiger als der Inhalt.
Um es auf den Punkt zu bringen: Ich bin für gleiche Rechte für alle. Punkt. Unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht und was es sonst noch so gibt. Und natürlich muss gleiche Arbeit (oder präziser: gleiche Leistung) auch gleich bezahlt werden. Alles andere wäre absurd. Aber all das ist kein Grund dafür, unsere Sprache unnötig zu verkomplizieren.
Ich habe mich deswegen für Pragmatismus entschieden: Texte in solchen, den Inhalt verkomplizierenden Schriftformen lese ich einfach nicht mehr. Von begeisterten Audi-Fans weiß ich, dass sie auf Grund dieses übergriffigen, sprachmoralisierenden Verhaltens schweren Herzens die Automarke gewechselt haben. Ein VW-Mitarbeiter zieht sogar gegen die Sprachvorgaben vor Gericht. Mutig von dem Herrn. Denn Mund aufmachen und Haltung zeigen sind eher selten ausgeprägte Verhaltensweisen in Unternehmen. Aber warum?
Sehnsucht nach Nestwärme
Eines haben wir alle gemeinsam: Das Bedürfnis, dazuzugehören. Das wurde uns während unserer 300.000 Jahre währenden Menschheitsgeschichte in die Gene gehämmert. Jeden Tag ging es um Leben und Tod. Nur wenn wir Mitglied eines Clans waren, hatten wir als Individuum eine Chance, in der Wildnis zu überleben. Anders formuliert: Wer aus dem Clan verstoßen wurde, stirbt.
Auch in der Wildnis der modernen Arbeitswelt spielt das Bedürfnis nach Zugehörigkeit immer noch eine große Rolle. Vielleicht wird es sogar immer wichtiger, da viele Menschen immer weniger Nestwärme in ihrem (privaten) Leben verspüren?
Familien zerbröseln zu kleinen Fragmenten. Manches Ehepaar gleicht eher Freunden, die im gleichen Haus wohnen. Selbst innerhalb der Kernfamilie kämpfen manche Väter und Mütter gegeneinander um Emanzipation, anstatt sich als Einheit zu verstehen. Wenn beide Eltern nach einem anspruchsvollen Arbeitstag abends erschöpft aufs Sofa fallen, ist weder Zeit noch Energie für die Kinder da. Zum Glück kann man sie mit der Playstation ruhig stellen — oder sie gleich zur Nanny oder ins Internat abschieben. Parallel wächst die Zahl der Single-Haushalte. Zwar scheinen viele das Single-Leben freiwillig und gerne zu wählen. Doch Fakt ist: Auf Dauer wartet abends nicht die gesellige Familie am Esstisch, sondern die einsame Kälte in der Wohnung.
Auch die Bedeutung von Religion und der Zusammenhalt in einer Glaubensgemeinschaft nehmen in unserer Gesellschaft zunehmend ab. Die Corona-Pandemie leistete dann durch das Verbot und die Vermeidung echter Begegnungen ihren Beitrag zur zunehmenden Entfremdung. Zwar sammelt man auf Facebook «Freunde»; doch auch wenn Sie davon Tausende haben, tragen diese noch lange nicht dazu bei, dass Sie sich zugehörig fühlen. Im Gegenteil: Teenager werden depressiv, wenn Sie ein paar Hundert weniger «Freunde» oder Likes bekommen als ihre Peer-Group. Nur der Fußball scheint nach wie vor als zweite Heimat immer noch zu funktionieren — und das Gefühl der Zugehörigkeit zu vermitteln ;-)
Wie viel Ehrlichkeit ist gewünscht?
Bei all diesen sozialen Strömungen ist es also nicht verwunderlich, dass für einige Menschen das berufliche Umfeld zur Ersatzfamilie geworden ist. Es wäre demnach «lebensgefährlich», aus diesem Clan verstoßen zu werden.
Zwar loben einige Menschen die offene Diskussionskultur in ihren Firmen. Doch hinter vorgehaltener Hand weiß jeder: Wenn Du das Falsche zur richtigen Person sagst, bekommst Du zwar mit einem netten Lächeln gesagt: «Vielen Dank für Ihre Meinung». Faktisch endet Deine Karriere trotzdem von nun an in einer Sackgasse. Diversity heißt eben noch lange nicht, dass auch wirklich alle Meinungen ausgehalten werden. Mal sehen, wie es für den Herrn ausgeht, der die Gendersprache bei Audi nicht mitmachen will.
Und so verbreitet sich — wider aller öffentlichen Bekundungen — in vielen Unternehmen immer noch das Gemocht-Werden-Wollen-Virus. Die Symptome: politisch korrekter Weichspüler, Wokeness, Cancel-Culture.
Gelebte Toleranz für vermeintliche Minderheiten reicht nicht mehr aus. Wenn Sie als Person im Unternehmen überleben wollen, müssen Sie jede Ausprägung von Individualität aktiv öffentlich unterstützen — und vor allem auch gut heißen.
Beispiel: In der Vergangenheit reichte es aus, wenn es Ihnen schlichtweg egal ist, welche sexuelle Orientierung Ihr Gegenüber hat — und Ihnen inhaltliche Zusammenarbeit wichtiger als die erotischen Vorlieben Ihrer Kollegen ist. Heute müssen Sie sich öffentlich bekennen: «Ich finde trans / schwul / … sein super.» — sofern Sie keine sozialen Sanktionen abbekommen wollen.
Akzeptanz ist für manche, die sich dem zwangsverordneten Umbauen unserer Gesellschaft verschrieben haben, einfach zu wenig. Aber soll verordnetes, missionarisches Zwangsbekenntnis der neue Standard werden? Alles für ein vermeintlich friedvolles, respektvolles Miteinander? In den Unternehmen erzählen die Menschen dann stolz von Ihrem Arbeitgeber: «Wir sind wie eine Familie». Ein gefährlicher Irrtum.
Unternehmen sind keine Familien, sondern Zweckgemeinschaften
Lassen Sie es mich klar formulieren: Unternehmen sind keine Familie. Es sind professionelle Zweckgemeinschaften mit dem Ziel, einen unternehmerischen Nutzen zu stiften. Heißt: Für Probleme Lösungen zu finden. Dazu entwickeln sie Produkte und Dienstleistungen, um damit Geld zu verdienen.
Nur weil einige Unternehmen die Sinn-Leere der Menschen versuchen zu füllen, indem sie einen «Purpose» versprechen, heißt nicht, dass das Unternehmen eine Familie für die Angestellten wird.
Der Grund ist einfach: Familienmitglieder können Sie nicht rausschmeißen. Mitarbeiter schon. Und das sollten Sie auch, wenn die Leistung auf Dauer nicht stimmt. Denn darauf kommt es am Ende des Tages an.
Arbeit ist eine Tätigkeit, mit der Sie für Ergebnisse sorgen. Punkt. Wer das auf Dauer nicht bringen kann, hat in dem Unternehmen nichts mehr verloren. Klingt hart. Ist aber so.
Was passiert dann, wenn Sie sich so sehr emotional an Ihre «Ersatz-Familie» klammern und das Unternehmen Ihnen kündigt? Dazu müssen Sie ja noch nicht mal Mist gebaut haben. Es reicht, wenn die Firma plötzlich eine wirtschaftlich schwere Zeit durchmacht. Dann verlieren Sie nicht nur Ihren Job, sondern zusätzlich Ihre gefühlte Familie. Emotional weiß jeder: Einen neuen Job kann man schnell finden. Eine neue Familie nicht so ohne Weiteres.
Trennen Sie Ihren persönlich-privaten Kern lieber von der beruflichen Welt. Natürlich können Sie in der Firma «familiär» miteinander umgehen. Sollten Sie vielleicht sogar. Aber halten Sie dennoch die notwendige Distanz und professionelle Nähe, um Klartext miteinander reden zu können.
Konflikte zwischen Menschen sind per se anspruchsvoll. Aus der Erfahrung mit vielen mittelständischen Familienunternehmen weiß ich, dass aus einem heiklen Terrain plötzlich eine «no-go Area» wird, sobald der Gegenüber nicht nur «jemand» ist, sondern «jemand aus der Familie». Wozu sollten Sie es sich also unnötig schwer machen, und Menschen als Familie bezeichnen, die einfach nur Kollegen sind?
Alles, was Sie nicht aussprechen, werden Sie ausleben
Ich denke, Streitkultur ist essenziell, wenn Sie Ihre Zukunftsfähigkeit sichern wollen. Denn wenn Sie die heiklen Themen nicht aussprechen, können Sie sie auch nicht lösen. Und noch viel schlimmer: Alles, was Sie nicht aussprechen, werden Sie ausleben.
Das Verhalten Ihrer Kollegin nervt Sie — aber Sie sprechen sie nicht darauf an? Schon bald werden Sie nicht mehr so hilfsbereit sein. Vielleicht schnippig reagieren, wenn sie etwas fragt. Oder gar in passiven Widerstand verfallen oder sie ins offene Messer laufen lassen, sobald sich eine intelligente Gelegenheit dazu ergibt.
Merken Sie sich: Sie können Personalthemen nicht aussitzen. Sie müssen Sie anpacken und zur Lösung treiben. Sonst verselbstständigt sich die negative Energie. Kein guter Plan.
Meinung sagen heißt: Streitkultur
Am besten fangen Sie gar nicht erst an, in das weichgespülte Geschwurbel des aktuellen Zeitgeists einzustimmen. Entscheiden Sie sich lieber für: hart in der Sache, fair zum Menschen.
Diskutieren, debattieren, austauschen — alles die falschen Begriffe. Lernen Sie, mit den Menschen in Ihrem Umfeld zu streiten.
Sie werden erleben: Die meisten Menschen verbinden mit Streit etwas Negatives. In der Folge wollen sie sich auch gar nicht streiten. Doch das ist falsch. Denn ein Streit ist nichts anderes als eine offen ausgetragene Meinungsverschiedenheit.
Wenn Ihnen «Streit» zu hart ist, nennen Sie es von mir aus Streit-Kultur. Kultur beinhaltet, dass der Streit nach gewissen Spielregeln abläuft. Für mich gehört dazu die oben genannte Essenz: Hart in der Sache, fair zum Menschen.
Manche meiner Kunden machen dann daraus vorsichtig eine respektvolle Streitkultur. Daran sehen Sie: Wir haben noch viel zu lernen auf unserem Weg in eine gute zwischenmenschliche — und gleichzeitig leistungsorientierte Zukunft der Arbeit. Am besten fangen wir dazu mit den Basics an: Weniger empfindlich werden — und gleichzeitig empfindsam bleiben.
IHNEN HAT DER TEXT GEFALLEN?
Weitere gedankliche Reibungsfläche finden Sie in meinem Buch «Führung stirbt nicht».
Oder abonnieren Sie meinen Newsletter «Holzer‘s Horizonte». Hier sende ich Ihnen ca. 6x im Jahr Artikel, Videos und Audio-Beiträge rund um Führung, Mut und Lebens-Führung zu.
Mit Mut durch die Veränderung
Das Leben ist voller Veränderungen. Wir können es sogar noch kürzer formulieren: Leben ist Veränderung! In unserer schnelllebigen Welt werden sie uns immer häufiger herausfordern. Besser, wir gewöhnen uns an sie — und lernen vor allem, souverän mit Veränderungen umzugehen. Ein Blick auf Ihre Innere Haltung kann dabei helfen.
Das Leben ist voller Veränderungen. Wir können es sogar noch kürzer formulieren: Leben ist Veränderung!
Veränderungen werden nie aufhören. Jeder Tag ist voll davon: Jemand schneidet uns auf dem Parkplatz den Weg ab und schnappt uns den Parkplatz vor der Nase weg. Schlüssel-Mitarbeiter gehen in die wohlverdiente Elternzeit und hinterlassen schmerzhafte Lücken im Team. Wettbewerber tauchen von völlig ungeahnten Flanken auf. Und Zuhause war eigentlich alles gut, doch auf einmal hängt — wie aus heiterem Himmel — der Haussegen schief.
Veränderungen werden uns in unserer schnelllebigen Welt immer häufiger herausfordern. Gewöhnen wir uns also lieber daran — und lernen wir vor allem, souverän mit ihnen umzugehen.
Verständliche Reaktionen — nur leider nicht hilfreich
Ob wir überhaupt emotional auf eine Veränderung reagieren, ist eine Frage der Dosis: Wie deutlich “spüren” Sie die Veränderung?
Erst wenn die Veränderung “intensiv” genug für Sie ist, werden Sie auch eine spürbare Reaktion zeigen. Wenn die Veränderung nicht gefällt, erlebe ich in der Praxis besonders zwei Reaktionen, die beide nicht hilfreich sind.
1.) Ärger
Wenn das Kind die Cola am Esstisch umstößt und sich die klebrige Pfütze über Klamotten, Tisch und Boden ausbreitet — ist das eine Veränderung. Manch dünn besaitete Eltern rasten jetzt aus. Andere bleiben gelassen und helfen, eine Lösung für das Missgeschick zu finden.
Oder im Büro: Ein Mitarbeiter hat die Kundenausschreibung nicht richtig gelesen — und in der Folge das Angebot zu spät eingereicht. Der attraktive Umsatz ist damit weg. Für wütende Führungskräfte eine prima Gelegenheit, auszurasten. Starke Anführer werden die Situation nicht ignorieren, bleiben jedoch souverän.
Und sicherlich ist Ihnen auf dem Parkplatz auch schon mal jemand quergekommen und hat Ihnen einfach den Parkplatz vor der Nase weggeschnappt. Aufregen oder cool bleiben — Sie haben die Wahl.
2.) Angst & SORGEN
Wenn die Auswirkungen von Covid-19 das bewährte Geschäftsmodell ins Wanken bringen, Umsätze einbrechen und es keine Planungssicherheit gibt, ist die Folge oft Angst. Im Deutschen formulieren wir: “Ich mache mir Sorgen.” Richtig, Sorgen hat man nicht; man macht sie sich.
Ängste und Sorgen sind menschlich. Doof daran ist: sie sind meist keine guten Ratgeber. Wer aus der Angst heraus eine wichtige Entscheidung trifft, macht das aus einer Position der Schwäche. Das fühlt sich nicht nur schlecht an, sondern führt später auch häufig zu Reue.
Aber wie kann es besser gehen?
Mut zur Veränderung
Gefühle und Emotionen zu ignorieren ist schwer. Sie bewusst zu verändern erst recht. Und gegen die eigene Gefühlslage zu handeln, ist auf Dauer ein Selbstmord-Kommando.
Ihnen bleibt nur, eine Entscheidung zu treffen. Entweder bleiben Sie Spielball Ihrer Gefühle und lassen sich in emotionale Handlungen treiben, die nicht immer intelligent sind. Oder Sie entscheiden sich dafür, das zu tun, was sinnvoll und hilfreich ist — trotz Ihrer Gefühle.
Ich habe keinen Weg gefunden, Gefühle auf Knopfdruck zu verändern oder abzuschalten. Deswegen habe ich mich für den pragmatischen Weg entschieden: Mutig sein.
Das heißt, trotz der “merkwürdigen” Gefühle in einer schwierigen oder ungewissen Situation, zu handeln. Aufzubrechen. Voranzugehen. Mich nicht von Ängsten, Sorgen, Wut oder Ärger treiben zu lassen. Sondern die Richtung zu wählen, die ich aus einer souveränen Haltung heraus für richtig halte.
Sie denken jetzt bestimmt: Klingt gut, ist aber nicht einfach. Und damit haben Sie recht. Wie können Sie diese souveräne Haltung finden? Ich biete Ihnen zwei Gefühlslagen an, mit denen ich mir selber und auch vielen meiner Coaching-Kunden schon oft helfen konnte. Fragen Sie sich: Wie würde ich mich in dieser Situation verhalten, wenn ich mit ... darauf reagiere?
1.) Neugierde / Hoffnung
Wir haben uns vor rund zwei Jahren einen Welpen zugelegt. Er erkundete die Welt: Offen, neugierig. So wie es auch Kinder tun. Beeindruckend ist: Er hat sich auch als erwachsener Rüde diese Neugier erhalten.
Ich weiß, dass es schwer ist, wenn eine harte Veränderung Sie in eine bedrohliche Situation gebracht hat. Wenn die Auswirkungen von Covid-19 Ihr Unternehmen zum Beispiel in Zahlungsschwierigkeiten gebracht haben. Oder Sie sich im Rosenkrieg auf dem Weg zur Scheidung befinden. Oder eine schwere Krankheit Sie erwischt hat.
Doch stellen Sie sich vor, wie Sie mit Neugier darauf reagieren. Neugier, einen Weg durch diese schwere Zeit zu finden. Und damit auch eine Hoffnung zu haben, dass Sie die Situation schon irgendwie meistern werden.
Damit Ihre Hoffnung Kraft und Stärke gewinnt, empfehle ich Ihnen, sich einen Horizont auszumalen. Wo wollen Sie hin? Wie sieht die Richtung aus, um durch die aktuelle Krise zu kommen? Und noch viel wichtiger: Wie fühlt es sich an, wenn Sie dort angekommen sind?
Ich habe den Eindruck, dass die Neugierde heutzutage vom Aussterben bedroht ist. Wir kennen schon alles. Haben fast alles. Und sind einfach nur satt. Und so trotten wir stumpfsinnig durchs Leben.
Hören Sie auf damit!
Das Leben ist eine Reise. Und Sie haben nur dieses eine Leben. Also genießen Sie, was gerade jetzt um Sie herum passiert — denn etwas Besseres bekommen Sie im aktuellen Moment nicht.
2.) Freude / positive Aufregung
Bevor Sie während einer Krise in Schockstarre oder blinden Aktionismus verfallen, ist es hilfreich zu wissen: Wo wollen Sie hin? Das gilt für Ihr Unternehmen — genauso wie für Ihr Leben. Sie brauchen einen Horizont.
Und wenn Sie den haben, dann können Sie aufbrechen. Was müssen Sie heute tun, um einen Schritt in Richtung Horizont zu machen? Denken Sie in der Dimension eines Tagewerks: Heute — Aufbruch — ein erster Schritt — Beute machen. Und dann: Ausruhen. Morgen geht’s weiter. Aufbrechen ist ein guter Start; Durchhalten bringt Sie ins Ziel.
Entfachen Sie eine positive Aufregung. Sie müssen im Angesicht einer akuten Krise ja nicht gleich in Freude ausbrechen. Aber Aufbruchstimmung — das ist das, was Sie benötigen!
Das Leben ist nicht immer eine Frage von Techniken, Tools und Methoden. Sondern zuallererst eine Frage Ihrer inneren Haltung. Macht es das einfacher? Nicht wirklich. Aber es hat auf jeden Fall etwas Gutes: Ihre Haltung liegt in Ihren Händen. Sie ist eine Entscheidung, die Sie treffen. Und dazu brauchen Sie erstmal niemand anderen.
In diesem Sinne: Begegne dem, was auf Dich zukommt, nicht mit Angst — sondern mit Mut und Zuversicht.
Ihnen hat der Text gefallen?
Dann lesen Sie doch mal in mein neues Buch “Mut zur Lebensführung” rein.
Corona – und die rosarote Hoffnung auf eine bessere Welt
Wir mögen es, wenn wir die Kontrolle haben. Wenn wir aktiv sind. Wenn wir den Lauf der Dinge bestimmen können. Spätestens seit Corona hat jeder verstanden: in Krisen ist auf einmal alles anders. Wir wissen plötzlich wenig. Und wenn wir ehrlich sind: fast nichts. Wie können wir mit dieser Ungewissheit umgehen? Und werden wir aus der Krise lernen?
Wir mögen es, wenn wir die Kontrolle haben. Wenn wir aktiv sind. Wenn wir den Lauf der Dinge bestimmen können. Spätestens seit Corona hat jeder verstanden: in Krisen ist auf einmal alles anders. Wir wissen plötzlich wenig. Und wenn wir ehrlich sind: fast nichts. Wie können wir mit dieser Ungewissheit umgehen? Und werden wir aus der Krise lernen?
Wer hätte in der Silvesternacht gedacht, dass ein Virus in Kürze die ganze Welt lahmlegen wird. Es sind die düsteren Berechnungen von Experten, die uns Sorge bereiten. Das Horror-Szenario des Massensterbens. Tritt dies wirklich ein? Werden wir überall in der Welt Verhältnisse wie in Italien bekommen? Ist die aktuell noch herrschende Ruhe in Deutschland in Wahrheit die Ruhe vor dem Sturm? Der Moment, in dem sich das Meer zurückzieht, bevor kurz danach der Tsunami mit brachialer Gewalt zuschlägt?
Corona sorgt für Ungewissheit. Wir kennen diesen neuen Feind noch nicht. Bei neuen Risiken hilft weder Verharmlosen noch Panikmache. Ein kühler Kopf ist gefragt. Gesunden Menschenverstand einschalten. Mitdenken. Aber auch mitfühlen. An andere denken. Heißt: Das Risiko klein halten. Im Falle von Corona also, den Virus daran hindern, dass er sich unkontrolliert ausbreitet.
Schockrisiken brauchen Vergleiche
Das Leben gibt es nicht ohne Risiken. Die meisten davon nehmen wir tagtäglich in Kauf, ohne darüber nachzudenken. Eine realistische Möglichkeit, in Deutschland zu sterben, ist, am Straßenverkehr teilzunehmen. Trotzdem verlassen wir immer wieder das Haus, um per Auto, Roller, Fahrrad oder zu Fuß das Risiko einzugehen.
Doch dann gibt es noch die Schockrisiken. Unbekanntes, was plötzlich auftaucht. Sei es eine neue Technologie. Ein neuer Wettbewerber. Eine Gesetzesänderung. Oder eben Corona. So ein Schockrisiko macht uns plötzlich panisch — oder lässt uns vor Schreck erstarren. Um jetzt handlungsfähig zu bleiben, ist es hilfreich, Schockrisiken mit bekannten Risiken ins Verhältnis zu setzen.
Die Grippe kostet jedes Jahr 290.000 bis 650.000 Menschen ihr Leben – obwohl es einen Impfstoff gibt. Trotzdem nehmen wir am öffentlichen Leben teil und verfallen wegen der Grippe nicht in Panik. Oder: jedes Jahr sterben in der EU 30.000 Menschen in einer Klinik, weil sie sich mit einem resistenten Keim infiziert haben. Trotzdem lassen wir uns operieren und verfallen wegen der Keime nicht in Panik.
Better safe than sorry
Um eine ungewisse Situation besser greifen zu können, brauchen wir also Fakten. Und dazu müssen wir Informationen hinterfragen. Das gilt in Unternehmen. Und auch bei Corona.
Sind die Corona-Todeszahlen überhaupt richtig? Der Virologe Hendrik Streeck war mit seinem Team in Heinsberg, der Stadt in NRW, wo Corona besonders stark verbreitet ist. Streeck berichtet von einem 78-jährigen Mann mit Vorerkrankungen (Quelle). Er wurde Corona-positiv getestet. Er starb jedoch an Herzversagen – ohne Lungenbeteiligung. Trotzdem wurde sein Tod in der Corona-Todesfallstatistik mitgezählt. Zurecht?
Wie sieht es mit der Mortalität des Virus aus? Forscher vermuten eine große Dunkelziffer an Infizierten, weil es viele Infizierte gebe, die symptomfrei sind und noch nicht getestet wurden. Wenn wir nun die Toten ins Verhältnis zur Summe aus Infizierten und Dunkelziffer setzen, sinkt die Mortalität des Virus. Wie aussagekräftig sind also die aktuellen Zahlen zum Virus?
Doch manche Informationen brauchen wir nicht hinterfragen. Denn sie sind einfach schrecklich. Wie die grausamen Berichte aus Italien. Menschen sterben qualvoll. Die Beatmungsgeräte reichen nicht aus. Ärzte sind gezwungen, über Leben und leider auch Tod zu entscheiden.
Was sollen wir in solch einer ungewissen Situation machen? Die Berichterstattung der letzten Wochen ging hin und her. Experten widersprechen sich. Die Medien formulieren nur noch Katastrophen-Schlagzeilen. Ich ziehe für mich das Resümee: Wir wissen einfach noch zu wenig über dieses Virus.
Insofern ist es für uns als menschliche Zivilisation nur richtig, wenn wir uns am schwächsten Glied in unseren Reihen orientieren: den Alten und Vorerkrankten. Und dann gilt: Better safe than sorry.
Menschen sind fehlbar
Was für uns als Gesellschaft heute Corona ist, war für mich damals die Diagnose Krebs. Es gibt viele Parallelen. Zunächst Schock. Ein unbekannter Feind. Hinterlistig und plötzlich in meinem Leben aufgetaucht. Extremer Handlungsbedarf. Raus aus dem normalen Leben: Job, Familie, Hobbies. Und rein in den Kampf: Klinik, OP, nuklearmedizinische Therapie.
Zweimal war ich in Quarantäne. Im Sicherheitstrakt. Hinter verschlossenen Türen. Hatte ein Einzelzimmer. Besuch musste hinter einer Mauer bleiben. Das Personal ebenfalls.
Und dann kam sie: auf einem Rollwagen schob der Arzt einen Metallkoffer mit einem Nuklear-Symbol drauf in mein Zimmer. Öffnet ihn. Holt eine kleine Tablette mit radioaktiv angereichertem Jod heraus. Reicht sie mir mit einer Art Pinzette. Ich halte sie in der Hand. Betrachte sie. Und der Arzt mahnt: „Nicht anschauen. Runterschlucken!“
Das Gefühl, vorrübergehend radioaktive Substanzen in meinem Körper zu haben, war alles andere als amüsant. Quarantäne und Ungewissheit strapazieren die Nerven und Ängste enorm.
Und dann kommt der Tag der Wahrheit. Blutuntersuchung. Ergebnisbesprechung mit dem Arzt. „Der Tumormarker ist leider noch nicht bei null. Ich empfehle Ihnen eine dritte Therapie. Diesmal mit der doppelten Strahlungsdosis.“
Ich war an einer sehr renommierten Klinik. Vor mir saß eine Koryphäe auf ihrem Gebiet. Aber seine Empfehlung hätte einen hohen Preis gefordert: nämlich extreme Kollateralschäden. Meine innere Stimme sagte mir: Zweitmeinung einholen.
Das tat ich dann auch in Köln. Die Ärzte untersuchten unaufgeregt und besonnen. Am Ende kam das überraschende Ergebnis: „Eine weitere Strahlentherapie bringt jetzt gar nichts. Denn das verdächtige Gewebe reagiert nicht mehr auf radioaktives Jod. Der einzige Weg zur Heilung ist eine zweite Operation“.
Als medizinischer Laie war ich sprachlos. Wie kann es sein, dass sich solche Top-Experten so eklatant in ihren Empfehlungen widersprechen? Der eine sagt Bestrahlung. Der andere: Die Bestrahlung bringt gar nichts; Sie müssen operiert werden.
Die Antwort ist einfach: Menschen sind fehlbar. Und ich bin dankbar, dass der Arzt aus Köln mit seiner OP-Empfehlung recht hatte. Und ich bin froh, dass ich auf ihn gehört habe.
Wenn Grenzen einmal überschritten sind
Wir wollen die Kontrolle über unser Leben. Klarheit. Sicherheit. Sehnen uns nach konkreten Handlungsempfehlungen. In unserem technokratischen Weltbild erwarten wir einfache und schnelle Lösungen. Wollen eine „Tablette“, mit der sich die Beschwerden sofort beseitigen lassen. Und so soll es bitte auch bei Corona sein.
Da der Feind Corona lebensbedrohlich ist, akzeptieren wir auch harte „Tabletten“. Aktuell sind wir im: Lockdown. Deutschland, Europa, die Welt steht still.
Ist es nicht erschreckend, mit welcher Geschwindigkeit unsere politischen Anführer die Welt lahmlegen? Wir akzeptieren wohlwollend Einschnitte in unseren Freiheits- und Persönlichkeitsrechten.
Dürfen uns nicht mehr frei bewegen. Nicht mehr versammeln. Auch nicht für Demonstrationen, sollten sie notwendig werden.
Handydaten werden an regierungsnahe Organisationen weitergeleitet, um die Bewegungsprofile der Bevölkerung zu überprüfen. In asiatischen Ländern werden sogar einzelne Personen digital verfolgt, um zu sehen: Halten sie sich an die Quarantäne? Mit wem waren sie in Kontakt?
Alle Maßnahmen haben ihr Gutes im Kampf gegen den Virus. Keine Frage. Aber alle Maßnahmen treten auch unsere demokratischen Grundregeln für ein freies Land mit Füßen.
Und aus der Erfahrung wissen Sie bestimmt: Ist eine Grenze einmal überschritten, dann gewöhnen wir uns daran.
Beim ersten Sex sind wir noch nervös, danach fällt es uns leichter.
Wer einmal fremdgeht, verliert die Hemmung, es auch noch einmal zu tun.
Wer einmal klaut, merkt, so schwer ist es gar nicht.
Wer 250.000 Euro für die Kaffeeversorgung seiner Mitarbeiter ausgibt, für den sind 10.000 Euro plötzlich Peanuts.
Wer einmal die Bevölkerung mit Angst dazu bringt, auf Freiheitsrechte zu verzichten, wird es in der nächsten Krise wieder tun.
Wer einmal persönliche Daten der Menschen sammelt und sie damit kontrollieren will, wird Gründe finden, es an anderer Stelle zu wiederholen.
Sie haben recht. All das muss nicht wieder passieren. Aber die Hemmschwelle, es wieder zu tun, die liegt nun niedriger, nachdem wir einmal eine Grenze überschritten haben.
Eine Krise darf uns nicht blind machen. Ja, wir müssen konsequent handeln. Aber trotzdem darf... nein: muss(!) ein kritischer Diskurs weiterhin stattfinden.
Wenn andere Meinungen, neue Ideen und das Hinterfragen des Mainstreams nicht mehr erlaubt sind, rennt die Gesellschaft wie Lemminge einer fanatischen Leitidee hinterher. Wie wir alle wissen, ein gefährlicher Weg.
Deswegen ist es mutig und richtig, dass Experten wie Hendrik Streeck sich trauen, auch mal einen besonnenen Kontrapunkt zu setzen: „Es könnte durchaus sein, dass wir im Jahr 2020 zusammengerechnet nicht mehr Todesfälle haben werden als in jedem anderen Jahr.“ (Quelle)
Nicht um zu verharmlosen. Sondern damit wir einen kühlen Kopf bewahren und mehr darüber lernen, welcher Bedrohung wir überhaupt gegenüberstehen.
Nach der Krise wird alles besser
Während meines Kampfes gegen den Krebs hatte ich zwischendurch immer wieder kurze Auszeiten. Verbrachte viel Zeit in der Natur. Ein paar Wochen auf einem ehemaligen Bauernhof eines Freundes. Wenn Sie so wollen: eine Art von freiwilligem Lockdown.
Ich erfreute mich am Sonnenschein. Beobachtete Fasan und Hase auf dem Feld. Und war geschockt, als ich nach ein paar Wochen mal wieder in die Großstadt zur Kontrolluntersuchung musste. Auf einmal war alles zu schnell. Zu bunt. Zu laut.
All das, was ich früher in und an der Stadt genossen habe, war nun zu viel und alles andere als erstrebenswert für mich. Ich sehnte mich nach der Ruhe auf dem Land.
Ähnliche Schnulzen lese ich bereits im Internet über die Zeit nach der Krise. Corona wird uns beibringen, dass wir nach dieser Krise gemeinschaftlicher, fairer und menschlicher miteinander umgehen.
Ehrlich? Daran glauben Sie?
Denken Sie zurück. Finanzkrise. Was haben wir daraus gelernt?
Schauen wir auf eine frühere Virus-Attacke zurück. MERS zum Beispiel. Im Januar 2014 schrieb der FOCUS dazu: „Die Bundesregierung warnt in einem offiziellen Bericht für den Bundestag vor der Gefahr einer Epidemie mit einem neuen gefährlichen Virus. Wie die ‚Bild‘-Zeitung vom Freitag berichtet, handelt es sich bei dem Erreger um ein sogenanntes Coronavirus mit der Bezeichnung ‚Mers-CoV‘.“ Was haben wir daraus gelernt?
Selbst jetzt, während der Coronakrise, sind die Lerneffekte überschaubar. Wir erleben die Janusköpfigkeit der Menschen. Auf Social Media predigen sie Solidarität, posten rosarot eingefärbte Texte über die Zukunft nach Corona und klatschen abends auf dem Balkon gemeinsam. Die gleichen Menschen am nächsten Tag im Supermarkt: sie hamstern 10 Packungen Mehl und prügeln sich ums Klopapier.
Gleiches auch auf dem internationalen Parkett: Trump denkt bei einem möglichen Impfstoff nicht an die Rettung der Menschheit, sondern an ‚America First‘ und will die Medizin exklusiv für die USA kaufen. Deutschland bestellt 6 Mio. dringend benötigte Atemschutzmasken – die dann irgendwo auf dem Transportweg von anderen Menschen geklaut werden (Quelle).
Noch vor ein paar Wochen war die tägliche Presse voll von Klimameldungen. Monatelang hörten wir von: Katastrophenszenarien. Aussterbenden Tierarten. Abschmelzenden Polkappen. Greta Thunberg und den Fridays for Future-Anhängern. Zurecht: die Bedrohungen für die gesamte Menschheit erscheinen mir bei der Vergewaltigung von Umwelt und Klima viel gefährlicher als beim Corona-Virus. Dennoch haben wir es nicht geschafft, mit internationaler Entschlossenheit die Natur zu schonen. Und prüfen Sie doch mal: Wie häufig berichten die Medien aktuell über den drohenden Klimakollaps? Oder haben wir das Thema etwa vor Corona bereits nachhaltig gelöst?
Als Menschheit handeln wir global weder einig noch konsequent. Stattdessen finden wir tausende Gründe, warum etwas nicht geht. Oder mehr Zeit braucht. Die Maßnahmen dürfen die Wirtschaft nicht gefährden. Kostet alles zu viel.
Und erleben plötzlich bei Corona: all das, was bisher unmöglich war, ist auf einmal möglich. Und zwar von jetzt auf gleich.
Wir fürchten eben den persönlichen Tod mehr als den Untergang der ganzen Menschheit. Das Gute daran: wir sind handlungsfähig — wenn wir wollen.
Vergessen statt lernen
Krisen sind kein Freifahrtschein zum Glück. Krisen machen weder die Welt noch den Mensch von alleine besser. Denn der Mensch neigt zum Vergessen.
Wir haben vergessen, was für eine schlimme Krankheit die Masern sind. Deswegen gibt es bereits einige Eltern, die ihre Kinder nicht mehr gegen Masern impfen lassen wollen.
Wir haben vergessen, was es heißt, während und nach einem Krieg Hunger zu leiden. Deswegen schaffen wir es als Weltgemeinschaft auch nicht, den 850 Mio. Menschen, die jedes Jahr an Hunger leiden, diese Qual zu ersparen.
Und wir werden vergessen, was es heißt, wegen Corona eingesperrt zu sein. Deswegen werden die meisten in den gierigen, egozentrischen Rausch zurück verfallen, sobald sich die Hamsterräder wieder drehen und die Tore der Konsumtempel öffnen.
Ich habe durch die Diagnose Krebs gelernt, dass mein Leben endlich ist. Und lebe seitdem natürlich nicht wie ein heiliger Engel. Weil die Erinnerung an den bedrohlichen Schmerz von damals verblasst. Zum Glück! Uns so esse ich auch Pizza, Chips und Cola. Schlafe nicht jeden Tag 8 Stunden. Und verschwende manchmal zu viel Energie auf unnötigen Nebenkriegsschauplätzen.
Eine Krise ist keine Heilung. Sondern eine Kreuzung. Du kannst Dich jetzt für einen neuen Weg entscheiden, wenn Du das willst.
Besserung heißt: Wir müssen uns anstrengen
Wenn wir nach der Krise einen neuen Weg einschlagen und uns ändern wollen, müssen wir uns anstrengen. Und dazu braucht es Anstrengungsbereitschaft.
Die Ernährung umstellen zu wollen, ist einfach. Es auch tatsächlich zu tun, ist anstrengend.
Regelmäßig Sport machen zu wollen, ist einfach. Es auch tatsächlich zu tun, ist anstrengend.
Nach Corona ein besserer Ehepartner, Vater, Mutter, Mensch sein zu wollen, ist einfach. Es auch tatsächlich zu tun, ist anstrengend.
Der Weg zum Besseren ist eine Entscheidung. Die Krise kann uns dabei helfen, diese Entscheidung zu treffen.
Und wenn Du Dich entschieden hast, dann brich auf. Und dreh dich nicht um. Es ist ein langer, anstrengender Weg zum Horizont.
Wie geht es weiter?
Was heißt das jetzt für unsere Corona-Situation? Es stellen sich viele drängende Fragen.
Wann können wir das öffentliche Leben und die Wirtschaft wieder hochfahren?
Halten die Menschen so lange durch?
Was machen wir, wenn wir zeitnah keinen Impfstoff finden und der Virus sich weiter ausbreitet?
Was passiert mit den Menschen, bei denen sich die finanzielle Schlinge bereits bedrohlich um den Hals gezogen hat?
Wie gehen wir mit den seelischen Folgen um, unter denen einige bereits jetzt leiden (Einsamkeit, Depression, häusliche Gewalt)?
Auf all diese Fragen haben wir heute noch keine Antwort.
Im Nebel der Ungewissheit bleibt uns nur, die stärkste Frage zu beantworten, die wir uns als Menschheit stellen können:
Wo wollen wir hin?
Auf welchen Horizont wollen wir als moderne Nomaden zustreben? Wie beim Puzzle brauchen wir ein Zielbild, eine Vorlage. Welche verlockende Zukunft gibt uns die Kraft, die aktuelle Ungewissheit durchzustehen?
Und wenn dieses Bild klar ist, dann jeden Tag Gegenwart machen.
Wahrnehmen, was heute ist.
Wahrmachen, was jetzt sein soll.
Und so stolpern wir Schritt für Schritt nach vorne. Auf das Schicksal zu warten, bringt nichts. Zukunft will von uns gestaltet werden. Tag für Tag. Moment für Moment.
Und vielleicht lernen wir dann ja doch etwas aus der Krise.
Als Staatengemeinschaft? Sehr wahrscheinlich. Die Regierungen werden vielleicht Institutionen einrichten. Geld zur Verfügung stellen. Für Forschungslabore. Forscher. Notfallpläne. Damit wir bei der nächsten Pandemie besser vorbereitet sind.
Als Menschheit? Ein kollektiv nachhaltiger Bewusstseinssprung nach dem Motto „Wir haben uns alle lieb“? Eher nicht.
Als einzelner Mensch? Das liegt in Ihren Händen. Was lernen Sie für sich aus der Krise? Wie wollen Sie sich verändern? Was sagt Ihnen Ihre innere Stimme? Sind das nur seichte Wünsche in der Not – oder ziehen Sie das auch durch, wenn die Krise vorbei ist? Das wird nicht so einfach. Denken Sie nur an all die frommen Neujahrsvorsätze. Aber es ist machbar. Wenn Sie das wollen!
In den Jahrtausenden unserer Evolution haben wir viele Krisen überstanden, weil der Mensch zwei Fähigkeiten besitzt: Intelligenz und Kooperation.
Und wer weiß: Wenn sich genug Menschen die richtigen Fragen stellen. Wenn jeder von uns etwas beiträgt, für ein gemeinsames, respektvolles Miteinander. Vielleicht lernen wir dann auch als Menschheit aus der Krise. Und die rosarote Brille der hoffnungsfrohen Träume wird auf einmal Realität.
Und nach der Krise leben wir tatsächlich in einer besseren Welt.
Darauf hoffe ich.
Und das wünsche ich Ihnen.
Im Herbst 2020 erscheint mein neues Buch zum Thema „Starke Anführer“. Melden Sie sich in meinem Newsletter an, um rechtzeitig informiert zu werden.
Wenn Sie Ihre Wirkung verstärken wollen, schauen Sie doch mal in meine Seminare Power of Influence oder Leadership Excellence.
Eines noch...
Das Stärkste,
was Sie tun können, ist:
Gegenwart machen!
Für und mit den Menschen.
Weitere Videos sowie meine Serie #CappuccinoFriday finden Sie auf meinem YouTube-Kanal.
Mut zur Haltung — Und unser Umgang mit Problemen
Wenn ich das Wort „Problem“ verwende, schrecken viele Menschen auf. Sie entgegen mir: „Das ist kein Problem. Sondern eine Herausforderung.“ Ich halte dieses Heile-Welt-Getue für gefährlich. Denn wenn das Wort Problem schon zu einem Problem geworden ist — wie wollen Sie dann die echten Probleme im Alltag lösen?
Wenn ich das Wort „Problem“ verwende, schrecken viele Menschen auf. Sie entgegen mir: „Das ist kein Problem. Sondern eine Herausforderung.“ Ich halte dieses Heile-Welt-Getue für gefährlich. Denn wenn das Wort Problem schon zu einem Problem geworden ist — wie wollen Sie dann die echten Probleme im Alltag lösen?
Was ist nur los in Deutschland? Ob Corona-Virus, Gender-Diskussion oder Impfgegner. Anscheinend ist ein Teil der Bevölkerung zu einem hypersensiblen Neurotiker geworden, dessen Nerven sowas von blank liegen, dass der kleinste Windstoß genügt, um einen emotionalen Orkan auszulösen.
Demokratie in Gefahr
In diesem absurden Schauspiel gehen wir sogar soweit, dass wir die Grundsätze unserer Demokratie aushebeln. Und keiner beschwert sich! Im Gegenteil: Das Bespucken demokratischer Prinzipien wird auch noch gefeiert.
Ich meine damit den Fall Thüringen. Es wurde ein FDP-Mann zum Ministerpräsidenten gewählt. Alles verlief genauso, wie es die demokratischen Spielregeln vorschreiben.
Und dann der Aufschrei: Das Ergebnis sei nicht hinnehmbar! Begründung: Die Wahl konnte nur mit den Stimmen der AfD gewonnen werden. Und solch ein Ergebnis dürfe man nicht akzeptieren. Forderung: Neuwahlen.
In meiner Wahrnehmung feierten das nicht nur die Medien, sondern auch die Öffentlichkeit. „Keinen Millimeter nach rechts!“ Eine wie ich finde richtige und sinnvolle Haltung. Doch dafür die Spielregeln unserer Demokratie aushebeln, nur weil wir mit einem Wahlergebnis nicht einverstanden sind?
Ich bin kein AfD-Wähler und stehe einigen Aussagen von Parteimitgliedern sehr kritisch, manchmal sogar fassungslos gegenüber. Aber: Die AfD ist - während ich das hier schreibe - immer noch eine demokratisch gewählte und nicht verbotene Partei in Deutschland. Und andere Meinungen muss unsere Demokratie, müssen wir, aushalten!
Was kann denn der FDP-Mann dafür, wer ihn wählt? Es wäre ein toller Moment gewesen, um als Politiker Führungsstärke zu zeigen. Stattdessen brach der Gewählte unmittelbar ein.
Stark wäre gewesen, wenn er die Wahl angenommen hätte. Und zwar trotz aller Aufschreie und Kritiken. Und dann ein Statement abgibt: „Ich werde meinen politischen Kurs genauso verfolgen, wie ich ihn vor der Wahl dargestellt habe! In welche politische Richtung die Wähler schauen, die mich gewählt haben, beeinflusst meinen Kurs nicht einen Millimeter. Null. Nada! Und damit wir uns richtig verstehen: Ich stehe auch nicht in der Schuld von irgendjemanden, nur weil er mir seine Stimme gegeben hat!“
Fehlender Mut zur Haltung
Aber starke Anführer haben wir in der Politik anscheinend nicht. Auf mich wirken die politischen Figuren eher wie Fahnen im Wind. Das Ziel: Gemocht zu werden. Der Weg: Bloß keine klaren Botschaften. Bloß keine Wählerstimmen riskieren.
Extrem treibt es die CDU für mich aktuell auf die Spitze. Denn eine Führungsspitze wollen dort viele schon nicht mehr. Doppelspitzen sind nun der Zeitgeist. Keiner will alleine Verantwortung tragen. Bis hin zu: Es muss eine Mann-Frau-Doppelspitze sein, sonst wäre man als Partei nicht mehr zeitgemäß.
Die Politik ist für mich ein Spiegelbild dessen, was ich in vielen Unternehmen erlebe - und auch im Alltag unserer Gesellschaft. Es fehlt der Mut zur Haltung.
Haltung bedeutet, eine Meinung zu haben. Haltung bedeutet, den Mund aufzumachen und zu seiner Meinung zu stehen. Haltung bedeutet, sich eindeutig mit seiner Meinung zu positionieren. Klartext statt Weichspüler!
Doch Klarheit hat einen Preis:
Je klarer Sie in Ihren Aussagen werden, desto mehr Menschen lehnen Sie ab.
Klarheit führt zu Ablehnung
Wenn es in der Öffentlichkeit geschieht, hat ablehnen im Neudeutschen einen neuen Namen bekommen: „Shitstorm“. Im kleineren Alltag nennen wir es Konflikt. Und da haben wir Schiss vor.
Und so erleben wir in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft immer mehr Menschen, die ihre Meinung in verbalem Weichspüler verstecken. So weiß niemand, wofür die Person inhaltlich steht. Ist für die Person aber auch nicht schlimm, denn durch die weichgespülten, politisch korrekten Aussagen eckt sie wenigstens nirgendwo an.
Eltern sprechen am Elternabend die kritischen Themen nicht an, aus Sorge, der Lehrer rächt sich mit schlechten Noten am Kind. Gleichzeitig spricht kein Lehrer mehr Klartext mit den Schülern. Auch wenn „Sie haben in Mathe eine 5, weil Sie faul waren!“ der Wahrheit entspricht, schweigt der Lehrer lieber, aus Sorge, dass die Helikoptereltern ihm das Leben schwer machen.
In Unternehmen kritisiert keiner den Chef, weil alle Sorge davor haben, dass ihr inhaltlich guter Einwand zu einem Ende der Karriereleiter führt. Verständlich: Zuhause will das Haus bezahlt und die Familie gefüttert werden. Gleichzeitig bietet niemand dem nervigen Kunden die Stirn, der völlig überzogene Forderungen stellt. „Der Kunde ist König“ heißt heute „Customer Centricity“, also verbiegen und verbeugen sich viele anstatt ihren Kunden souverän auf Augenhöhe zu begegnen.
Das Problem mit dem Problem
Vielleicht denken Sie sich jetzt: „Die bisher genannten Beispiele sind ja auch heikle Themen. Da geht der Betroffene ein persönliches Risiko ein, indem er sich offen mit seiner Meinung positioniert.“ Richtig. Deswegen rate ich Ihnen auch: Choose Your Battles. Wählen Sie die Schlachten, in die Sie ziehen.
Und trotzdem: Die Sorge vor „blauen Flecken“, die Angst vor Konflikt und sozialer Missbilligung darf uns nicht davon abhalten, das Richtige zu tun. Und das Richtige ist zumindest, dass wir wahrhaftig miteinander umgehen.
Der Preis des verbalen Weichspülens ist groß. Denn die Angst vor den großen „Schmerzen“ hat sich bereits so in die Seele einiger Menschen gefressen, dass selbst bei kleinsten Kleinigkeiten der „Mut“ zur Haltung fehlt.
In einem Führungsworkshop erläuterte ich meine These: Veränderungen führen zu Problemen. Wenn nicht sofort, dann auf jeden Fall im Laufe der Zeit. In der Pause kam eine Mitarbeiterin auf mich zu. Sie sagte: „Herr Holzer, wir dürfen das P-Wort hier nicht verwenden“. Irritiert schaue ich Sie an: „Welches P-Wort meinen Sie?“ Sie schaut auf das Flipchart und zeigt auf das Wort „Problem“.
Reden Sie Klartext
Ich weiß, dass Worte Kraft und Wirkung haben. Deswegen sollten Sie auch nicht von einem dominanten Gesprächspartner reden. Denn „dominant“ impliziert automatisch, dass Sie sich Ihrem Gesprächspartner unterordnen. Sprechen Sie also lieber von einem anspruchsvollen, oder von einem schwierigen Gesprächspartner.
Aber fangen Sie bitte nicht an, das Wort Problem weichzuspülen. Herausforderung. Möglichkeiten. Chance. Lassen Sie den Quatsch!
Ich hatte in der Schule Mathe Leistungskurs. In jeder Stunde schrieb ich: Problem Doppelpunkt. Und dann? Lösung Doppelpunkt. Genauso wie Tausende andere Mathematiker. Naturwissenschaftler. Forscher. Weltweit. Täglich.
Probleme sind nichts Schlimmes. Probleme sind gut. Denn Probleme sind zum Lösen da. Punkt!
Ruhig bleiben
Es ist unglaublich hilfreich, wenn Sie sich daran gewöhnen, den Begriff Problem ohne Scheu zu verwenden. Denn Ihr Leben ist voller Probleme.
Während der Besprechung haben Sie Durst, aber das Wasser ist leer. Was machen Sie? Lösen, indem Sie neue Flaschen organisieren.
Sie haben viel getrunken und müssen während des Meetings auf Toilette. Was machen Sie? Lösen, indem Sie aufstehen und das WC besuchen.
Am Waschbecken gibt es keine Handtücher mehr. Was machen Sie? Lösen, indem Sie Toilettenpapier verwenden.
Ihr Leben ist voller Probleme. Und nun halten Sie bitte einen Augenblick inne — und denken Sie über folgende Frage nach: Wie viele Probleme haben Sie, die Sie einfach lösen — ohne dass Ihnen überhaupt bewusst geworden ist, dass Sie ein Problem haben?
Richtig: 99,9%!
99,9% Ihrer Probleme lösen Sie einfach so. Ohne mit der Wimper zu zucken. Es sind diese wenigen 0,1% der Probleme, die plötzlich wie ein tödliches Monster Ihre Emotionen hochkochen lassen.
Vor vielen Jahren bekam ich die Diagnose Krebs. Das ist ein tödliches Problem. Im Vergleich dazu erscheinen mir die 99,9% der anderen Probleme meines Lebens geradezu lächerlich.
Das Blöde ist: Für viele Menschen lösen diese 99,9%-Harmlos-Probleme ähnliche Gefühle aus wie die 0,1%-Gefahr-Probleme. Das geht mir - trotz der blöden Krebs-Erfahrung - auch manchmal so. Aber das sollte uns nicht in die Falle führen, dass wir wegen unangenehmer Gefühle gleich alle Probleme verteufeln.
Nochmal: Sie lösen 99,9% aller Probleme, ohne dass Sie merken, überhaupt ein Problem gehabt zu haben.
Also hören wir mit dem dünnhäutigen Geheule auf. Lassen Sie uns an unserer Haltung arbeiten. Stark werden. Nennen wir das Kind beim Namen: Wir haben ein Problem!
Und dann machen wir das, was Geld bringt. Was unser Überleben sichert. Probleme lösen! Und zwar hart in der Sache. Und immer fair zum Menschen.
Im Herbst 2020 erscheint mein neues Buch zum Thema „Starke Anführer“. Melden Sie sich in meinem Newsletter an, um rechtzeitig informiert zu werden.
Wenn Sie Ihre Wirkung verstärken wollen, schauen Sie doch mal in meine Seminare Power of Influence oder Leadership Excellence.
Eines noch...
Das Stärkste,
was Sie tun können, ist:
Gegenwart machen!
Für und mit den Menschen.
AUF IHRE KOMMENTARE UND MEINUNGEN ZUM ARTIKEL FREUE ICH MICH.
Weitere Videos sowie meine Serie #CappuccinoFriday finden Sie auf meinem YouTube-Kanal.
Pflicht zum Widerspruch
Man pinkelt die Hierarchie-Leiter nicht nach oben. Doch was ist, wenn die Meinung „da oben“ falsch ist? Wenn Sie sogar rechtswidrig ist? Schnell geraten Sie in innere Konflikte. Wollen Klartext reden. Scheuen gleichzeitig die möglichen Konsequenzen. Doch die entscheidende Frage bleibt: Wenn Sie ein Problem erkannt haben, wie lange warten Sie, bis Sie es ansprechen?
Man pinkelt die Hierarchie-Leiter nicht nach oben. Doch was ist, wenn die Meinung „da oben“ falsch ist? Wenn Sie sogar rechtswidrig ist? Schnell geraten Sie in innere Konflikte. Wollen Klartext reden. Scheuen gleichzeitig die möglichen Konsequenzen. Doch die entscheidende Frage bleibt: Wenn Sie ein Problem erkannt haben, wie lange warten Sie, bis Sie es ansprechen?
Mit Mitte 20 wurde bei mir ein Schilddrüsen-Krebs diagnostiziert. Doch vor der Bedrohung durch den Krebs hatte ich zunächst gar nicht so viel Angst. Mehr Sorgen machte mir das Risiko, dass ich durch die OP meine Stimme verlieren könnte. Denn der Stimmbandnerv verläuft in unmittelbarer Nähe der Schilddrüse.
Endlich ein Termin in der Klinik. Ich sitze im Sprechzimmer des Spezialisten und frage: „Werden Sie meinen Stimmbandnerv mit Neuromonitoring während der OP darstellen?“ Diese Technik ermöglicht es, während der Operation die Funktionsfähigkeit des Nerves zu überprüfen. Für mich ein wichtiges Argument, um mich zumindest sicherer zu fühlen. Der Arzt antwortet: „Nein, das tue ich nicht.“
Ich hinterfrage ihn und bestehe darauf, dass ich diese Technik gerne verwendet wissen möchte. Resolut fährt er mich an: „Wie kommen Sie überhaupt dazu, meine Kompetenz in Frage zu stellen und beurteilen zu können, wie die Operation abzulaufen hat?“ Damit war die Beziehung zu diesem Möchtegern-Arzt für mich vorbei. Mit den Worten „Von Ihnen werde ich mich nicht operieren lassen“ verabschiede ich mich von ihm. Wer keinen Widerspruch aushält, verliert meinen Respekt.
Wenn ich an diese Situation zurückdenke, dann war das nicht leicht. Die Diagnose Krebs hing wie eine dunkle Wolke über mir. Ein diffuses Gefühl von Ungewissheit, Unsicherheit und Angst vermischte sich mit Kampfeswille, Motivation und der Bereitschaft, alles zu geben, um gesund weiter zu leben. Und dann begegnet Dir auf einmal der lebensrettende Spezialist in einer herablassend-arroganten Art und Weise, die Deinen hoffnungsfrohen Optimismus mit Füßen tritt.
Ich fand zum Glück am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg einen Spezialisten, der mir sympathisch war und der jede OP mit Neuromonitoring durchführte. Und Gott sei Dank: ich bin seit vielen Jahren gesund - und konnte meine Stimme behalten.
War es schlau von mir, den Mund aufzumachen und in die Meinungsverschiedenheit einzusteigen? War es richtig, aufzustehen und sich nicht vom ersten Arzt operieren zu lassen? Wie hätten Sie sich in dieser Situation verhalten?
Obrigskeitshörigkeit
Die Frage ist sicherlich nicht einfach zu beantworten, wenn Sie nicht selber in der Situation sind. Und ich hoffe, dass Ihnen solche extremen mentalen Trainingsräume, in denen es um Leben und Tod geht, erspart bleiben. Doch die gleichen Herausforderungen begegnen Ihnen auch im Alltag.
Ihr Chef trifft eine Entscheidung. Sie haben viel mehr Informationen als er und erkennen, dass diese Entscheidung falsch ist. Sie ahnen: mit seiner Entscheidung wird das Projekt vor die Wand fahren. Machen Sie jetzt den Mund auf und weisen Sie ihn auf den Fehler hin? Oder halten Sie lieber die Klappe, da Sie nicht wollen, dass Ihre Karriere an einem gläsernen Dach stecken bleibt?
Grundschule - Elternabend mit der Klassenlehrerin. Ihr Sohn hatte sich mehrfach bei Ihnen beschwert sich, dass die junge Dame ständig die Mädchen aus der Klasse bevorzugt behandelt. Machen Sie jetzt den Mund auf und stellen Sie sie zur Rede? Oder beschwichtigen Sie Ihren Sohn und halten lieber die Klappe, weil Sie befürchten, dass die Lehrerin sich mit schlechten Noten rächen könnte? Und überhaupt: Sollte man in der heutigen Zeit der Emanzipation lieber gar nichts gegen Frauen sagen, da man sofort als „frauenfeindlich“ abgestempelt wird?
Statusunterschiede sind der wesentliche Verhinderer für Klartext. Wir sind obrigkeitshörig. Brav buckeln wir nach oben oder ordnen uns eine Mehrheit unter, auch wenn wir eine andere Meinung haben. Das ist verständlich. Und es ist falsch!
Probleme können Sie nicht aussitzen
Wenn es um heikle Botschaften geht, sind zwei Zeitpunkte kritisch.
Problem erkannt. Wenn Ihnen das Verhalten eines Kollegen, Nachbars oder Familienmitglieds nicht gefällt. Oder Sie erkennen, dass irgendetwas schief läuft und sich zu einem größeren Problem entwickeln könnte.
Problem angesprochen. Etwas erkennen oder wissen reicht nicht. Entscheidend ist, dass Sie auch den Mund aufmachen und es ansprechen.
Die Kunst ist, den Zeitabstand zwischen „Problem erkannt“ und „Problem angesprochen“ möglichst kurz zu halten. In manchen Situationen ist es ratsam, eine Nacht über Ihre Entscheidung zu schlafen, bevor Sie handeln. Erfahrungsgemäß ist das der längste Abstand — und die Ausnahme. In der Regel sollten Sie Probleme viel schneller ansprechen.
Stellen Sie sich vor, wie die Welt wäre, wenn Menschen Probleme zügig ansprechen. Bei der Beratung McKinsey gehört die Pflicht zum Widerspruch („obligation to dissent“) seit vielen Jahren zur Unternehmenskultur. Im Hedgefonds Bridgewater des Milliardärs Ray Dalio wird nicht nur die Pflicht zum Widerspruch gelebt, sondern absolute Transparenz. Ständig bewerten sich die Mitarbeiter gegenseitig. So werden Probleme, Qualitätsmängel, Zeitverschwendung und Co. sofort aus dem Weg geräumt. Doch viele Menschen reagieren bei diesen beiden Unternehmen zurückhaltend, weil Sie diese Art des Miteinanders als kühl und rational — in gewisser Weise als unmenschlich — empfinden. Wirklich?
Überlegen Sie einmal: Wie viel unnötiger Ärger könnte Ihnen erspart bleiben, wenn alle Klartext reden?
Doch in der Realität sind wir weit von Klartext entfernt. Viele Menschen erkennen zwar die Probleme. Doch sie halten den Mund. Als würde dadurch ihr Umfeld nicht mitbekommen, dass irgendetwas nicht stimmt. Absurd. Denn selbst wenn Sie nichts sagen, wird das Problem Auswirkungen auf Sie und Ihr Umfeld haben. Prüfen Sie dazu folgenden Satz:
Alles, was Sie nicht aus-sprechen, werden Sie aus-leben!
Wenn das Verhalten Ihres Kollegen Sie richtig nervt und Sie es nicht ansprechen, wird sich Ihr Verhalten ändern. Sie meiden die Nähe. Weichen Gesprächen aus. Unterstützen ihn nicht mehr so gerne, wenn er Ihre Hilfe braucht.
Wenn Ihr Lebenspartner etwas macht, das Ihnen nicht gefällt oder Sie gar verletzt — und Sie es nicht ansprechen — werden Sie Ihr Verhalten verändern. Vielleicht fangen Sie an, ebenfalls verletzend zu werden. Oder Sie beginnen Streitereien wegen anderen Nichtigkeiten. Oder Sie finden sich plötzlich in den verständnisvollen Armen einer Affäre wieder, die Ihnen all das gibt, was Sie in Ihrer Beziehung so sehr vermissen.
Pflicht zum Widerspruch
Wenn Sie also Probleme gar nicht verheimlichen können, da Sie sie sowieso ausleben, dann können Sie auch gleich den Mund aufmachen. So haben Sie zumindest die Chance, gemeinsam den Missstand zu beheben.
Die Herausforderung ist: das Ausleben geschieht meist unbewusst. Wenn Sie dagegen den Mund aufmachen und das Problem ansprechen, dann ist das eine aktive Entscheidung, die Sie treffen. Und Entscheidungen kosten Kraft. Überwindung. Und somit auch eine gewisse Form von Mut.
Weichen Sie dieser Entscheidung trotzdem nicht aus. Denn sie ist richtig, auch wenn Sie mal mehr, mal weniger schmerzhaft ist. Die meisten Menschen scheuen den Konflikt. Doch Sie haben die Pflicht, den Mund aufzumachen, wenn Sie anderen Menschen helfen wollen.
Ein Mensch nervt Sie mit seinem Verhalten. Wie soll er sich denn verbessern können, wenn Sie ihm nicht mal die Chance dazu geben? Und Sie geben ihm die Chance, indem Sie ihn auf sein Missverhalten hinweisen.
Bildhaft gesprochen: Sie stehen vor Ihrem Team und halten eine Rede. Die Leute schmunzeln. Tuscheln. Irgendetwas scheint im Busch zu sein. Doch Sie wissen nicht, was. Verunsichert machen Sie trotzdem weiter. Nach dem Vortrag gehen Sie auf Toilette. Und merken dort: Ihr Hosenstall war die ganze Zeit offen.
Wie doof ist das denn? Und wie super wäre es gewesen, wenn Sie jemand diskret darauf hingewiesen hätte. Problem erkannt - Problem schnell angesprochen. Dann hätten Sie ihn geschlossen und einen super Vortrag gehalten. Der Hinweis des Kollegen hätte sich für Sie wahrscheinlich unangenehm angefühlt. Aber dieser kurze Schmerz ist allemal besser, als zu wissen, dass Sie die ganze Zeit wie ein Heiopei mit offener Hose vor Ihren Leuten gestanden hatten.
Kultur des gepflegten Streitens
Es wird dringend Zeit, dass wir lernen, besser mit heiklen Botschaften, Meinungsverschiedenheiten und Konflikten umzugehen. Doch leider haben wir noch ein fast neurotisches Verhältnis zum Streiten.
Entweder reagieren wir übertrieben empfindlich. Dann sind alle auf einmal Randgruppen, die sich diskriminiert fühlen. Klartext wird ständig als persönliche Härte verstanden. Rechte Meinungen werden sofort als rechtsradikales Gedankengut verurteilt. Einzelne Worte werden aus dem Kontext gerissen und in der Diskussion empört zerrissen.
Oder wir fügen so viel verbalen Weichspüler in die Gespräche, dass am Ende niemand mehr weiß, was jetzt eigentlich gemeint ist. Anstatt klarer Ansagen, was geht und was nicht geht, gibt es sowohl-als-auch-Gelaber. Statt mutiger Entscheidungen wird rumgeeiert.
Mund aufmachen ist eine Frage von Respekt. Und zwar Respekt Ihnen selbst gegenüber, dass Sie sich nicht innerlich verbiegen, sondern Haltung zeigen. Und Respekt anderen gegenüber, dass Sie Ihnen durch Klartext dabei helfen, besser zu werden.
Wenn Sie also in der nächsten Diskussion auf eine andere Meinung treffen, dann hören Sie der Person doch erstmal zu. Schieben Sie Ihre eigene Meinung zur Seite. Seien Sie neugierig: wie kommt er auf diese Meinung? Versuchen Sie, zu verstehen, warum die andere Person so denkt, wie sie denkt. Vielleicht entdecken Sie ja neue Perspektiven. Seien Sie dann so flexibel, dass Sie Ihre eigene Meinung bei Bedarf korrigieren.
Wenn Sie trotz Zuhören und Verstehen wollen zum Schluss kommen, dass Ihre Meinung doch die richtige ist: dann stehen Sie auch dazu und verteidigen Sie sie. Auch wenn das am Ende vielleicht dazu führt, dass Sie und Ihr Gesprächspartner in dieser Sache keinen gemeinsamen Nenner finden.
Es ist Ihre Pflicht, den Mund aufzumachen, wenn etwas falsch ist. Klartext reden ist menschlich. Wehret den Anfängen!
Eines noch...
Das Stärkste,
was Sie tun können, ist:
Gegenwart machen!
Für und mit den Menschen.
>> Zur Übersicht aller Blog-Beiträge
>> Mehr zum Thema Mut und Haltung finden Sie in meinem Buch “Mut braucht eine Stimme”
Weitere Videos sowie meine Serie #CappuccinoFriday finden Sie auf meinem YouTube-Kanal.
Wer Sicherheit will, muss etwas wagen
Wie sehr haben Sie sich bereits an das moderne Leben gewöhnt? Mobiles Arbeiten statt fester Arbeitsplatz, Netflix statt Videothek, Google statt Bibliothek und Tinder statt Gespräch an der Bar. Die Welt scheint uns zu Füßen zu liegen. Doch die Gefahr des modernen Lebens ist, dass wir so sehr darauf spezialisiert sind, dass wir den Anschluss an den Fortschritt verpassen.
Wie sehr haben Sie sich bereits an das moderne Leben gewöhnt? Mobiles Arbeiten statt fester Arbeitsplatz, Netflix statt Videothek, Google statt Bibliothek und Tinder statt Gespräch an der Bar. Die Welt scheint uns zu Füßen zu liegen. Doch die Gefahr des modernen Lebens ist, dass wir so sehr darauf spezialisiert sind, dass wir den Anschluss an den Fortschritt verpassen.
Dieses Jahr mache ich keinen wirklichen Sommerurlaub, da ich meine Sommerpause nutze, um mein zweites Buch zu Ende zu schreiben. Wir sind nur ein paar Tage mit Freunden an die luxemburgische Grenze gefahren, um ein paar Tage auszuspannen. Das alte Haus, in dem wir übernachten, sollte ein guter Lehrmeister für mich werden.
Die Illusion von Geschwindigkeit
Abends kommen wir an. Das Gepäck ist auf die Zimmer gebracht. Auf dem Herd köcheln bereits die Nudeln. Und ich will noch schnell in die Dusche springen, bevor wir essen. Unsere Freundin kommentiert das mit einem Grinsen: „Schnell ist hier nicht“.
Ich laufe die Treppe hoch und als ich im Bad angekommen bin, verstand ich, was sie damit meint: es gibt kein fließend warmes Wasser im Haus. Wenn Sie warm duschen wollen, müssen Sie erstmal einen Ölofen anwerfen — und warten.
Warmwasser in der Küche? Gibt es. Doch auch hier bekomme ich eine Lektion im Entschleunigen. Denn erst muss ich kaltes Wasser in einen Boiler laufen lassen - und dann erhitzen. Das Prozedere dauert gut 10 Minuten. Also heißt es ebenfalls: warten.
Am nächsten Morgen bin ich der erste, der wach ist. Während ich darauf warte, dass das Wasser für den Kaffee kocht, setze ich mich auf die Terrasse und will schnell die Nachrichten auf Spiegel Online lesen. Doch ich bekomme nur ein drehendes Ladesymbol zu sehen. Der Grund: kein 3G, geschweige denn LTE. Also heißt es auch hier: warten. Und so blieb mir nur, das Handy zur Seite zu legen und dem Morgenkonzert der Vögel zu lauschen bis der Kaffee endlich fertig ist.
Nichts ist selbstverständlich
Mir wurde in diesen Tagen bewusst, wie sehr ich mich an die Normalität des modernen High-Tech-Lebens gewöhnt habe. Ich erwarte einfach, dass warmes Wasser aus dem Hahn kommt, wenn ich ihn aufdrehe. Ich erwarte, dass es überall schnelles Internet gibt. Oder allgemein formuliert: Ich erwarte, dass Ergebnisse sofort verfügbar sind.
In den Unternehmen haben sich die Menschen ebenfalls an das moderne Leben im Geschwindigkeitsrausch gewöhnt. Erfolg ist kein Ziel, sondern eine Selbstverständlichkeit. Der Umsatz muss steigen. Der Gewinn sowieso. Veränderungen werden einmal erklärt — und dann muss es laufen. Neue Geschäftsmodelle bekommen 10 Monate, um sich zu beweisen.
Doch auch die Angestellten laufen verblendet und verwöhnt durch den Alltag: Dreizehn Monatsgehälter. Firmenwagen. 30 Tage Urlaub. Ausreichend Feiertage obendrauf. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.
Privat geht das Konzert der Erwartungshaltungen weiter: Supermärkte, in denen wir kaufen, was wir wollen. Und wenn die Geschäfte mal geschlossen oder etwas nicht vorrätig haben, bestellen wir einfach per Smartphone. Dank Express-Lieferung halten wir das Ergebnis noch am selben Tag, spätestens aber am Folgetag in den Händen. Ob Lebensmittel, Blockbuster-Film oder Lebens(abschnitts)partner — alles ist nur einen Wisch entfernt.
Doch all das ist alles — nur nicht selbstverständlich. Die ersten erfolgsverwöhnten Unternehmen erleben bereits, was es heißt, wenn die Wachstumskurve ihrer Branche plötzlich nicht mehr nach oben zeigt, sondern nach unten stürzt. Pervers ist, dass es einige Manager gibt, die selbst dieses Taumeln noch als „negatives Wachstum“ bezeichnen.
Die warnenden Veränderungen der heutigen Zeit sind sicherlich nur Vorboten, die wir aus Bequemlichkeit mehr oder weniger ignorieren. In unserem Wachstumsrausch machen wir lieber ungehemmt weiter und vergewaltigen den Planeten. Der Preis dafür ist noch nicht fällig. Die Zeche werden wir später bezahlen müssen. Dann, wenn wir die Auswirkungen noch häufiger und vor allem noch unangenehmer zu spüren bekommen. Spätestens wenn die Klimakrise uns mit voller Gewalt am Hals packt und zudrückt, werden wir lernen, dass das moderne Leben alles ist — nur nicht selbstverständlich.
Es wird niemals ruhig
Doch warum sind die Zeiten so turbulent und ungewiss? Verlassen wir mal die Turbulenzen unseres Alltags und schauen wir von weiter oben auf das bunte Treiben. Warum gibt es eigentlich die ganzen Veränderungen? Wo kommen Sie her?
Dahinter steckt ein unsichtbarer Treiber: die Evolution. Sie wirkt wie eine unsichtbare Hand. Die dadurch verursachten Veränderungen sind also nichts anderes als sichtbar gewordene Evolution. Sie arbeitet mit voller Kraft — und wir Menschen sind nur kleine Spielfiguren auf dem Spielbrett namens Leben.
Die Evolution können wir nicht stoppen. Genauso wenig wie Veränderungen. Im Gegenteil: Veränderungen sind elementarer Bestandteil des Lebens. Selbst wenn Sie hoffen, dass alles so bleibt wie es ist, wird sich irgendwann irgendwo irgendetwas „von alleine“ verändern.
Im Unternehmen bekommen Sie auf einmal Lieferprobleme. Ihr Wettbewerb nutzt diese Chance, und bietet Ihren Kunden nicht einfach nur Ware an — sondern er senkt auch noch drastisch die Preise, um die Gunst der Stunde zu nutzen und Sie durch aggressives Abwerben von Kunden in den Ruin zu stoßen. Derweil verlieren Sie auf einmal wichtige Schlüsselpersonen Ihres Teams, weil die Personen in eine andere Stadt umziehen, abgeworben oder schwanger werden.
Wenigstens Zuhause lief es bis jetzt ganz gut. Bis auf einmal der blaube Brief des Sohnes auf dem Esstisch auf Sie wartet. Oder Ihr Lebenspartner neue Inspiration in einer Affäre sucht. Oder Sie bis jetzt gesund und munter waren, aber auf einmal doch einen Arzt aufsuchen müssen, weil plötzlich unangenehme Symptome aufgetreten sind.
Probleme sind der beste Lebensbeweis
Veränderungen führen also zu Problemen. Vielleicht ist nicht jedes Problem so dramatisch, dass Sie es als „Problem“ bezeichnen würden. Denn die meisten Menschen sehen ein Problem als etwas Gravierendes, und vor allem Negatives. Aber wenn wir uns darauf einigen, dass ein Problem nichts anderes als eine Aufgabe oder Herausforderung ist, können wir vereinfacht sagen: Veränderungen führen zu Problemen. Und was machen Sie mit einem Problem? Richtig: lösen!
Ihre Aufgabe — egal ob beruflich oder privat — ist es, für gute Lösungen zu sorgen.
Der Kreislauf des Lebens
Und wenn Sie eine Lösung umsetzen, was haben Sie dann? Eine neue Veränderung. Und damit schließt sich der Kreislauf des Lebens.
Der Motor des Lebens, die Evolution, treibt die Veränderungen weiter an. Wir Menschen unterstützen sie dabei, indem wir zusätzlich auch noch selber weitere Veränderungen anstoßen. Die Veränderungen werden also häufiger und schneller in unser Leben treten. In der Folge haben wir auch mehr Probleme.
Probleme sind also der Beweis dafür, dass Ihr Unternehmen noch nicht insolvent ist — und Sie als Mensch noch nicht gestorben sind. Die Fähigkeit, in diesen bewegten Zeiten für gute Lösungen zu sorgen, halte ich für eine Schlüsselfähigkeit. Wenn Sie also heute und in Zukunft einen sicheren Arbeitsplatz haben wollen, sollten Sie in der Lage sein, Menschen zu guten Lösungen zu führen.
Veränderung führt zu Sicherheit
Das blöde an dem Kreislauf Veränderungen > Probleme > Lösungen ist, dass die Zukunft eben nicht vorhersehbar ist, sondern ungewiss. Und Ungewissheit gefällt den meisten Menschen nicht. Denn sie löst ein Gefühl der Unsicherheit aus.
Doch es gibt einen Ausweg: Folgen Sie Ihrer Neugier. Wenn Sie unzufrieden sind mit dem Status Quo, wird Ihre Neugier Ihnen den Weg aufzeigen, wie Sie die Situation verbessern können. Sie haben eine gewisse Vorstellung, wie die Situation komfortabler oder sicherer für Sie sein könnte. Doch diese Sicherheit hat einen Preis: Sie müssen das Risiko eingehen und etwas Neues wagen.
Brechen Sie aus dem bekannten Status Quo aus und werden Sie selber zum Treiber der Veränderung. Als Unternehmen sorgen Sie dafür, dass neue Produkte und Dienstleistungen entwickelt werden. Als Angestellter besuchen Sie Fortbildungen, um neue Fähigkeiten zu erlernen. Für alle Menschen gilt: Klammern Sie sich nicht am Bekannten fest, sondern bleiben Sie in Bewegung. Denn Ihre Bewegung bedeutet, dass Sie sich den veränderten Rahmenbedingungen anpassen. Und wer sich am besten anpassen (verändern) kann, wird die besten Überlebenschancen haben.
Formen Sie die Welt
Wer jedoch verharrt. Zögert. Den Kopf in den Sand steckt. Oder die Augen verschließt. In der Hoffnung, es wird schon alles von alleine irgendwie gut gehen... Der wird zur Beute der Veränderung. Ob die Evolution dann nur mit Ihnen spielt und Sie überleben. Oder ob Sie vom Wandel gefressen werden, wird sich dann zeigen. Ich würde mich jedoch nicht darauf verlassen, dass andere oder die äußeren Umstände es schon für Sie richten werden.
Folgen Sie lieber Ihrer Neugier und akzeptieren Sie, dass die Situation morgen garantiert anders sein wird als heute. Der Wandel ist scharf, schnell und unerbittlich. Die Vergangenheit ist vorbei und wird so nie wieder kommen. Das macht auch nichts. Ihre Fähigkeit, sich selbst und Ihre Umwelt zu verändern, ist Ihre stärkste Waffe im Kampf gegen die Ungewissheit. Denn wenn Sie sich permanent verändern, können Sie eine Zukunft gestalten, in der Sie auch morgen gerne und gut leben wollen.
Wo wollen Sie hin? Brechen Sie auf!
Eines noch...
Das Stärkste,
was Sie tun können, ist:
Gegenwart machen!
Für und mit den Menschen.
>> Zur Übersicht aller Blog-Beiträge
>> Mehr zum Thema Mut und Haltung finden Sie in meinem Buch “Mut braucht eine Stimme”
>> Im Herbst 2020 erscheint mein neues Buch zum Thema Führung.
Wenn Sie informiert bleiben möchten, tragen Sie sich hier ein.
Weitere Videos sowie meine Serie #CappuccinoFriday finden Sie auf meinem YouTube-Kanal.
Wofür es sich heute noch zu träumen lohnt
Wir zeigen jeden Tag, wie glücklich, erfolgreich und souverän wir sind. Doch hinter der Fassade lauert unsere Angst, über die niemand offen spricht. Wir drohen zum Spielball des unkontrollierten Fortschritts zu werden. Doch wofür lohnt es sich eigentlich heute noch, zu träumen?
Wir zeigen jeden Tag, wie glücklich, erfolgreich und souverän wir sind. Doch hinter dieser Fassade lauert unsere Angst, über die niemand offen spricht.
In meinen Coachings begegnen mir Menschen, die „es“ geschafft haben. Eigentlich. Es sind Unternehmer und Top-Führungskräfte. Sie verdienen sehr gut. Haben ein schickes Haus. Eine tolle Familie. Müssen beim Einkaufen nicht auf jeden Euro achten. Machen unvergessliche Urlaube. Sie leisten sich die neuesten technischen Gimmicks. Tragen teure Uhren. Fahre beeindruckende Autos. Und zu Ihrer Geburtstagsparty kommen 30-40, manchmal auch 100 Gäste. Sie stehen in der Mitte und Blüte ihres Lebens. Und sind dennoch unzufrieden.
Doch darüber sprechen sie normalerweise nicht. Denn diese Unzufriedenheit fühlt sich komisch an. Manche beschreiben sie als „gehetzt, getrieben, rastlos“. Andere als „besorgt und verunsichert“. Manche sogar als „verletzt, traurig, niedergeschlagen“. Aber solche dunklen Abgründe passen nicht in unsere moderne Gesellschaft. Hier zählt es, gut drauf zu sein. Zuversichtlich, optimistisch, dynamisch und motivierend. Stark und souverän. Bloß kein Weichei, Spielverderber oder Skeptiker sein.
Wenn wir den Statistikern glauben, ist die Welt im Laufe der Zeit viel besser geworden. Aber diese gute Botschaft ist in uns noch nicht angekommen. Tiefenpsychologische Couchgespräche von Meinungsforschern zeigen immer wieder – in den Deutschen brodelt Wut. Eine Wut, die durch Selbstkontrolle noch im Zaum gehalten wird – und bisher nur stellenweise ausbricht. Solche Eruptionen zeigen sich dann in Form von Krawall in Chemnitz oder den steigenden Wählerstimmen für die AfD.
Doch warum fühlen wir uns so? Ich sehe vor allem zwei Gründe, weswegen wir die glorreiche Moderne nur mit Angst und Wut genießen.
Legebatterien für Funktionsmenschen
Zum einen haben wir uns eine Kunstwelt geschaffen, für die wir nicht geeignet sind. Moderne Büro-Skylines sind zwar beeindruckend. Doch gleichzeitig erinnern sie mich an Legebatterien für Funktionsmenschen. Jeden Tag marschieren sie – schick verkleidet – in die Büros. Und dann geht der moderne Büro-Krieg los.
Die wesentliche Spielregel lautet: Wir gehen respektlos miteinander um. Aus Sorge, im rasenden Innovations-Wettrennen den Anschluss zu verlieren, wird mit Macht, Druck und Dominanz geführt. Alle sollen mutig sein und neue Dinge ausprobieren, aber keiner darf einen Fehler machen, denn sonst wird der Schuldige sanktioniert. In der Folge wird statt Klartext weichgespült und die Fahne in den Wind gehangen. Bloß nicht die Karriereleiter nach oben pinkeln. Und so herrscht in vielen Unternehmen ein Klima der Angst.
Intrigen und versteckte Spielchen machen den sowieso schon zermürbenden Arbeitsalltag auch noch kompliziert. Wir laufen nicht nur im Hamsterrad, sondern wir legen auch noch verletzende Hindernisse hinein und drehen gleichzeitig die Geschwindigkeit immer höher. Agile Methoden greifen um sich. Alles muss am besten gestern schon fertig sein. Wir leiden unter dem Instant-Virus.
Die Sehnsucht nach Ruhe
Doch bei all dem Lärm und der Geschwindigkeit sehnen wir uns nach Ruhe. Deswegen fahren wir als Ausgleich zum Bürowahnsinn am Wochenende „in“ die Natur. Da frage ich mich: wo waren wir denn während der Woche? Außerhalb der Natur? Wir haben uns von der Natur getrennt. Nicht nur im Sprachgebrauch. Sondern auch in unserem täglichen Verhalten.
Und wenn wir mal „in“ der Natur sind, bewegen wir uns auf Kunstschneisen, die wir in den Wald geschlagen haben. Diese nennen wir Wege. Denn zu viel Natur darf es dann doch nicht sein. Wenn es kreucht und fleucht, sticht und piekst oder einfach nur zu dreckig wird...
Doch wir merken bei all der sauberen Technik in unserer klinischen Kunstwelt: ohne Natur geht es nicht. Das spüren wir innerlich. Und holen uns dann wenigstens in bisschen davon nach Hause. Wir nennen das dann einen Garten. Doch der gefällt uns nur, wenn auch er klinisch sauber ist: die Hecke in Form, der Rasen akkurat – alles für ein optisch stimmiges Erscheinungsbild. Doch auch hier gibt es bereits tumorartige Auswüchse, wenn die Menschen ihren Garten statt mit Bäumen und Blumen nur mit Steinen “bepflanzen”.
Und so verlieren wir im technischen Fortschritt langsam immer mehr den Bezug zu uns selbst.
Fehlender Horizont
Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, dann war es schon super modern, wenn ich mich morgens per Modem in eine Mailbox einwählte, um die Ergebnisse der NBA Playoffs runterzuladen. Das Ganze dauerte rund fünf Minuten. Für eine Tabelle mit Zahlen. Heute schauen wir bei 160km/h auf der Autobahn Videos im Smartphone an – und regen uns auf, wenn die Übertragung ruckelt.
Uns ist gar nicht bewusst, wie viel Rechenpower wir mit diesem kleinen Gerät in den Händen halten. Nämlich mehr, als damals ein Großrechenzentrum in Form eines ganzes Bürokomplexes zu bieten hatte. Mein Smartphone hat 128 GB Speicherkapazität. In den Rechenzentren standen damals waschmaschinen-große Kisten mit einer Kapazität von 500 MB. Heißt: mit meinem Smartphone habe ich 256 Waschmaschinen in der Hosentasche. Und dieser technologische Fortschritt passierte gerade mal in knapp 20 Jahren.
Digitalisierung, Internet der Dinge, Robotik, künstliche Intelligenz, Blockchain, Gentechnik – es gibt so viele unglaublich beeindruckende Durchbrüche in der Forschung. Mit einem atemraubenden Tempo werden wir von Innovationen überrannt.
Doch wozu eigentlich?
Warum brauchen wir all diesen Fortschritt? Ich habe nicht den Eindruck, dass wir hier als Menschheit einen Plan verfolgen. Im Gegenteil: es wird gemacht, was machbar ist. Und wenn es nicht machbar ist, forschen wir solange, bis wir doch einen Weg gefunden haben.
Wir benutzen die Technik nicht, um unser Leben zu verbessern. Es ist genau anders herum: der Fortschritt benutzt uns, um stattzufinden. Wir sind Werkzeuge der Evolution. Und wir stellen selber das Tempo immer höher, ohne zu wissen, in welche Richtung wir eigentlich laufen.
Mittlerweile können wir menschliche Stimmen digital nachbilden. Wir können Videos in Echtzeit manipulieren. Die humanoiden Roboter sehen seit Sophia immer mehr wie wir Menschen aus. Es naht der Tag, da wissen wir nicht mehr, ob wir mit einem Mensch oder einer Maschine kommunizieren. Wir werden nicht mehr wissen, was echt oder eine Fälschung ist. Fake News sind da nur der lächerliche Anfang.
Der technische Fortschritt wird uns mit ungewohnten Fragen konfrontieren:
Werden wir uns in Maschinen verlieben?
Welche Auswirkungen hat das auf unsere Seele?
Haben intelligente Maschinen und Roboter die gleichen Rechte wie wir?
Wer wird bevorzugt in einer Firma befördert: künstliche Intelligenz oder der Mensch?
Wie gehen wir mit Menschen um, die auf Grund des rasenden (!) Fortschritts keine Zeit haben, sich an den modernen Arbeitsmarkt anzupassen?
Dürfen Algorithmen über Personalfragen entscheiden – wer eingestellt, befördert oder entlassen wird?
Darf eine Maschine über unser Schicksal bestimmen – wenn Roboter als Polizisten arbeiten und von ihrer Schusswaffe Gebrauch machen? Oder wenn ein autonom fahrendes Auto in einen unvermeidlichen Crash gerät und sich nun aktiv dafür entscheidet, entweder das Leben der Insassen oder das der Fußgänger aufs Spiel zu setzen?
Uns fehlt als Gesellschaft der Horizont. Stattdessen diskutieren wir über den Diesel-Skandal, Brexit oder die Karriere des umstrittenen (Ex-) Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Wir brauchen keine Kosmetik auf dem Status-Quo. Wir brauchen dringend ein Bild der Zukunft. Das uns zeigt, wo wir hin wollen. Das uns Orientierung gibt. Das Investitionen bündelt. Das uns als Gesellschaft vereint. Das uns klare Leitplanken gibt, was wir wollen – und vor allem auch was wir nicht (!) wollen.
Beispiel: Sie erwarten Nachwuchs. Der Arzt sagt Ihnen, dass das Baby im Bauch einen Gendefekt hat und krank zur Welt kommen wird. Sie können dies durch Genmanipulation verhindern und ein gesundes Kind auf die Welt bringen. Finden Sie Genmanipulation jetzt richtig?
Es beginnt meist damit, dass wir etwas erfinden, um einen Missstand zu heilen. Oder eine Situation zu verbessern. Doch dann werden wir gierig. Wenn wir heilen können, können wir auch designen. Was wäre, wenn Sie durch gezielte Genmanipulation Ihrem Kind ein paar Verbesserungen „einpflanzen“: Mathe-Genie, Sprachtalent, attraktive Körpergröße, durchsetzungsstarkes Wesen, kräftige Muskulatur, ...
Um zu wissen, was geht – und was nicht gehen darf ! – brauchen wir ein Zukunftsbild:
In was für einer Welt wollen wir eigentlich leben?
Da es dieses Bild nicht gibt, rennen wir mit einem beeindruckenden Tempo orientierungslos durch die Gegend. Jeder macht das, was er machen will.
Ein unbegrenzter Liberalismus predigt uns: alles ist möglich. Just do it! Doch Liberalismus braucht Grenzen!
Fressen oder gefressen werden
Schauen wir nochmal in die Natur. Der Stärkere frisst den Schwächeren. Oder der Schlauere besiegt den Dümmeren. Gut ist, wenn Sie oben in der Nahrungskette stehen. Denn es gilt: fressen oder gefressen werden.
Aber wollen wir so leben? Wer beim technischen Fortschritt nicht mithält, fliegt einfach raus? Was machen Sie als Taxifahrer, wenn Sie morgen keinen Job mehr haben, weil das Taxi selbständig fährt? Sie arbeiten einfach als Big-Data-Spezialist – auch wenn Sie keine Ahnung von Computern haben?
Als ich in Karlsruhe mit dem Taxi zu einer Konferenz fuhr, brachte es der Fahrer auf den Punkt: „Ich suche mir einen anderen Job. Und wenn es nicht mehr legal funktioniert, muss ich mir eben andere Wege suchen, um meine Familie zu ernähren.“
Als moderne Zivilisation muss das doch besser funktionieren. Wir haben in Deutschland die soziale Marktwirtschaft. Marktwirtschaft allein bedeutet: fressen oder gefressen werden. Der Zusatz „sozial“ erweckt den Eindruck, dass wir uns dadurch vom Tier unterscheiden. Sozial bedeutet, dass wir eine Zivilisation gebaut haben, die durch Werte und Leitplanken dafür sorgt, dass Fortschritt stattfindet, ohne die Würde des Menschen zu verletzen. Dass Fortschritt nicht um jeden Preis stattfindet, sondern zum Wohle unserer Gemeinschaft. Wobei ich den Eindruck habe, dass die Tiere das Soziale schon von Natur aus einfach können – und vor allem auch besser machen als wir.
Die Angst in uns
Vor uns liegt irgendetwas, das wir nicht sehen können. Und das ist die Ursache für diese diffuse Angst in uns Menschen. Obwohl es gut läuft, spüren Sie dieses komische Gefühl in sich: irgendetwas stimmt nicht... Es ist die Ungewissheit. Dieser Nebel, der vor uns liegt. Wir wissen einfach nicht, was auf dem Weg in die Zukunft auf uns lauert. Und so kann Ungewissheit zu Unsicherheit führen. Doch auf jeden Fall schürt Ungewissheit die Angst.
Wenn ich an die Zukunft denke, dann sehe ich viele Chancen und unglaubliche Möglichkeiten, sich als Mensch zu entfalten. Die Technik wird uns ungeahnte Freiheiten und Potenziale schenken. Ein schönes Bild. Nur der Weg durch diesen Nebel der Ungewissheit, der weckt ins uns dieses komische Gefühl.
Und deswegen reden wir darüber nicht so gerne. Wir lenken uns lieber im Hier und Jetzt ab. Betäuben uns durch viel Arbeit, neue Projekte, hohe Geschwindigkeit, tolle Hobbies, Unternehmungen mit Freunden, Serien-Marathons auf Netflix oder die obligatorische Flasche Wein am Abend.
Doch Ablenken, Betäuben oder Kopf in den Sand stecken sind nicht die Lösung. Populisten oder Möchtegern-Gurus hinterherzurennen, die wie Brüllaffen ihre einfachen Lösungsparolen für komplexe Fragestellungen in die Welt posaunen, ebenfalls nicht.
Zukunft ist nicht vorhersehbar. Wir müssen sie gestalten.
Dieser Schwelbrand in uns hat auch sein Gutes: denn Unzufriedenheit ist der Motor für Veränderungen.
Und es ändert sich eine ganze Menge. Besonders zuversichtlich stimmt mich das, was ich aus den Gesprächen mit Jugendlichen mitnehme. Sie wollen oft keine „blinde“ Karriere um jeden Preis machen. In ihnen ist die Frage nach dem Sinn schon fest verankert. Sie wollen Karriere machen, indem sie etwas Sinnvolles für diese Erde, unsere Gesellschaft und andere Menschen tun.
Und dieser neue Mindset trifft auf eine Zeit, in der es endlich gesellschaftsfähig wird, sich selbständig zu machen. Unternehmen zu gründen und nicht stupide in die bestehenden Karrierepfade einzutreten. Diese neue Generation wird die Art, wie wir Wirtschaft und Zukunft gestalten, mit ihrer neuen Denkrichtung in eine sinnvolle Richtung lenken.
Doch dazu braucht es in unserer Gesellschaft wieder mehr Mut. Mut, den Mund aufzumachen. Eine Meinung zu haben, die auch unbequem sein darf. Wir brauchen wieder mehr besonnene Diskussionen, die hart in der Sache, und fair zum Menschen sind. In der wir den Menschen wieder richtig zuhören – nicht nur, was ihr Kopf sagt, sondern auch was aus ihrem Bauch kommt.
Denn nur wenn wir aufnehmen, was Menschen bewegt, können wir sie auch in eine sinnvolle Richtung führen. Das gilt in Unternehmen – wie auch in unserer Gesellschaft. Und dann haben wir auch eine Chance, dass wir den guten Inhalten wieder mehr Aufmerksamkeit schenken – und nicht den populistischen Brüllaffen.
Dazu brauchen wir keine Revolution von oben. Wir brauchen keine Merkel, keinen Papst oder andere Leitfiguren, die uns sagen, wo es lang geht. Zum Glück: denn es fehlen uns aktuell die starken Führungspersönlichkeiten, die Zukunft im Sinne von einer sozialen Marktwirtschaft gestalten wollen.
Das Gute ist: der notwendige Wandel kann auch “von unten” passieren. Indem jeder Einzelne sich an die eigene Nase packt, auf seine innere Stimme hört und dann als Vorbild vorangeht. Die Summe der Einzelmenschen und ihre Entscheidungen ergeben das Große unserer Gesellschaft. Wir entscheiden, durch das was wir jeden Tag tun – oder nicht tun, wie unsere Zukunft aussieht. Und die stärkste Kraft der Masse ist in einer Marktwirtschaft nunmal der Konsum.
In was für einer Welt willst Du leben? Und was tust Du heute konkret dafür?
Auf Ihre Kommentare (weiter unten unter dem Text) freue ich mich. Und wenn Ihnen der Beitrag gefällt, helfen Sie mir, dass er seinen Weg in die Welt findet. Also teilen erlaubt :-)
>> Zur Übersicht aller Blog-Beiträge
Wer Sicherheit will, muss Risiken eingehen
Die meisten geben es nicht zu: aber viele Menschen lassen sich durch ihre Angst leiten. Ob beruflich oder privat: Angst beeinflusst Ihre Gedanken und Ihre Handlungen – und damit auch, wie Sie sich fühlen. Ein riskanter Weg, der in einer Sackgasse endet.
Die meisten geben es nicht zu: aber viele Menschen lassen sich durch ihre Angst leiten. Ob beruflich oder privat: Angst beeinflusst Ihre Gedanken und Ihre Handlungen – und damit auch, wie Sie sich fühlen. Ein riskanter Weg, der in einer Sackgasse endet.
Ich habe es selbst oft genug erlebt – und beobachte es in meinen Coachings regelmäßig: wer Sicherheit will, muss Risiken eingehen. Das gilt in allen Lebensbereichen. Ich erzähle Ihnen drei Geschichten und bin gespannt, wie Ihre Haltung zu meiner These ist.
Eheglück
Als ich damals das Herz meiner heutigen Frau erobert habe, war die leichte Aufgabe erfüllt. Die eigentliche Herausforderung begann danach: ein Leben lang glücklich verliebt zu bleiben. Und hier stellte ich mich – sagen wir mal positiv formuliert – ungeschickt an.
Als Mann gibt man das nicht gerne zu. Aber tief in meinem Herzen sehnte ich mich nach Sicherheit. Wer will schon gerne emotional verletzt werden. Das Problem war, dass ich mich damals mit solchen Themen nicht wirklich beschäftigt habe. Selbstreflektion war ein Fremdwort. Das einzige, was zählte, waren Business, Erfolg und der abgedroschene Spruch „Zahlen, Daten, Fakten“. Eine Haltung, die ich teuer bezahlen musste...
Denn unbewusst übernahm meine Sehnsucht nach emotionaler Sicherheit die Kontrolle über mein Verhalten. Sie suchte sich den einfachsten Weg zur Sicherheit, indem sie eine Schutzmauer um mein Herz baute. Heißt konkret: ich ließ mich nicht 100%-ig auf die Beziehung zu meiner Frau ein. Zeigte wenn, dann nur andeutungsweise Gefühle. Und fuhr sozusagen mit emotionaler Handbremse.
Das ist für mich aus heutiger Sicht nachvollziehbar. Wenn das Herz nicht verletzt werden will, schützt es sich eben.
Ähnliches erlebe ich bei jedem dritten Unternehmer, den ich coache, und auch im privaten Freundeskreis. Ein Freund traf sich mit einer neuen Internet-Bekanntschaft. Es lief aber nicht so wirklich rund. Ich fragte ihn, was sie sich denn per SMS schreiben. Er zeigte mir den Chat-Verlauf.
Ich stutzte und fragte ihn: „Warum schreibst Du ihr nicht, dass Du sie vermisst?“
Seine prompte Antwort: „Auf keinen Fall.“
Ich: „Warum denn nicht?“
Er: „Das ist zu offen. Wenn sie dann nicht antwortet, stehe ich blöd da.“
Aus den beiden ist natürlich nichts geworden. Seine Erwartungshaltung „Die Frau ist sowieso die Falsche“ wurde sozusagen bestätigt. Da es mit den beiden noch gar nicht richtig losgegangen war, war der Preis ein kleiner.
Bei mir war die Folge meines Sicherheits-Strebens gravierender, denn ich habe dadurch fast meine Ehe verloren. Es nutzt einfach nichts, wenn man seine Gefühle und Emotionen hinter einem Staudamm zurückhält. Denn dann weiß der Partner nicht, wo er dran ist. Das Verhalten wirkt vielleicht zögerlich. Oder unsicher. Und sorgt auf jeden Fall für Irritationen, Angst und Konflikte. Der Weg zu wahrer Liebe geht in die andere Richtung: mit Offenheit, Verletzlichkeit und Unsicherheit.
Den Krebs besiegt
Mit Mitte 20 wurde bei mir Schilddrüsen-Krebs diagnostiziert. Damals war ich auf einem beruflichen Höhenflug in der Finanzbranche unterwegs. Die Diagnose Krebs zerstörte mein verblendetes Gefühl der Unsterblichkeit.
Damals war ich ein Kontroll-Mensch – und bin es heute immer noch. Zumindest ist es mir lieber, einen Plan zu haben und Stellschrauben zu kennen, mit denen ich eine Situation oder ein Ergebnis beeinflussen kann. Doch heute gehe ich gelassener damit um, dass eben nicht alles kontrollierbar ist. Denn ich erhielt eine heftige Lektion. Und zwar auf dem OP-Tisch.
Die Behandlung meines Tumors bearbeitete ich strukturiert wie ein Projekt. So akribisch, genau und engagiert hatte ich bis dato noch nicht gearbeitet. Ich ging davon aus, dass ich durch diese Kontrolle Sicherheit bekomme.
Dann kam der Tag der OP. Auf die Beruhigungstablette hatte ich verzichtet, so dass ich noch klar bei Verstand war. Das Risiko der Operation war, dass ich meine Stimme verlieren könnte. Also murmelte ich zum Anästhesisten: „Passen Sie auf meine Stimme auf!“ Doch er antwortete nur ruhig: „Herr Holzer, jetzt ist es Zeit, uns zu vertrauen.“ und leitete das Betäubungsmittel ein...
Ich musste mich in diesem Moment einfach führen lassen und die Kontrolle abgeben. Mich also „verletzlich“ geben und die Unsicherheit gehen.
Erst säen, dann ernten
Ich begleitete mal eine Unternehmerin dabei, ihr Unternehmen auf die nächste Ebene zu entwickeln. Ihre Firma war in einer kritischen Phase: zu klein, um einen Durchbruch zu erzielen. Und zu wenig Mittel, um die notwendigen Investitionen zu tätigen. Was also tun?
Die Arbeit potenzierte sich – und zwar auf ihrem Schreibtisch. In der Gründungsphase war sie der Treiber. Ihre Haltung „Der Laden läuft wegen mir“ hat dafür gesorgt, dass es nach wenigen Jahren bereits richtig gut lief. Aber eben noch nicht gut genug. Und ihre Haltung legte sich nun wie eine Schlinge um den Hals. Vom Treiber des Wachstums ist sie zur Bremse geworden. Es war zu viel. Sie kam nicht mehr hinterher.
Die Lösung: neue Mitarbeiter einstellen. Doch dazu fehlte das Geld. Wir diskutierten diese Situation intensiv. Am Ende war ihr klar: sie hatte Angst. Angst davor, zu investieren, ein Risiko einzugehen, das sich am Ende nicht bezahlt machen würde.
Sie sehnte sich nach einem Gefühl von Sicherheit. Damit verband sie ein erfolgreiches Unternehmen, in dem sie nicht der Flaschenhals ist, sondern gute Mitarbeiter die Arbeit machen. Und sie erkannte, dass sie für diese Sicherheit zunächst einmal in die Unsicherheit muss. Ohne das Risiko, Geld in neue Mitarbeiter zu investieren, würde sie diese Sicherheit nie erreichen.
Und so hat sie ein Darlehen aufgenommen. Drei neue, gute und damit auch teure Mitarbeiter eingestellt. Und schaut heute mit einem stolzen Schmunzeln auf diese „gute alte“ und lehrreiche Zeit zurück.
Der Widerspruch der Sicherheit
Wer also Sicherheit will, muss in die Unsicherheit gehen. Es ist wie ein Paradox, also ein Widerspruch in sich. Doch nur, wenn Sie etwas im Leben wagen, wird sich auf Dauer Ihre Situation verbessern.
Dazu braucht es hin und wieder auch Mut. Mut den Mund aufzumachen und ins Tun zu kommen. Pläne schmieden und träumen reicht nicht. Sie müssen es auch umsetzen. Und vielleicht hilft Ihnen dabei noch ein Gedanke: oft ist es gar nicht der Schritt in die Unsicherheit. Sondern es ist nur eine Ungewissheit, die Sie zurückhält. Doch sie brauchen nur loszulaufen – und Sie werden sehen: der Weg wird klar, wenn Sie ihn gehen!
Passend zum Artikel finden Sie hier ein Video aus meiner YouTube Serie #CappuccinoFriday. Jeden Freitag erscheint eine neue Folge, in der ich ein Thema für Sie auf den Punkt bringe. Schauen Sie doch mal rein und abonnieren Sie den Kanal.
Gleichberechtigung der Frau - leider falsch verstanden
Unsere Gesellschaft wandelt sich. Auch bei der Frage, wie wir mit Mann und Frau umgehen. Das ist auch bitter nötig. Nur leider verselbständigt sich der Verbesserungskurs ins Absurde. Von Bank-Formularen bis hin zur Anpassung der Nationalhymne. Für mich sind das die Auswüchse einer neurotischen Gesellschaft, die nicht mehr den Blick aufs Wesentliche hinbekommt.
Unsere Gesellschaft wandelt sich. Auch bei der Frage, wie wir mit Mann und Frau umgehen. Das ist auch bitter nötig. Nur leider verselbstständigt sich der Verbesserungskurs ins Absurde. So wurde eine geschlechterneutrale Sprache für die deutsche Nationalhymne diskutiert. Dort soll es dann „Heimatland“ statt „Vaterland“ und „couragiert“ statt „brüderlich“ heißen. An anderer Stelle klagte eine Dame vor Gericht, dass Sie auf den Formularen ihrer Bank nicht mit „Kunde“, sondern mit „Kundin“ angesprochen werden wolle. Für mich sind diese beiden Beispiele Auswüchse einer neurotischen Gesellschaft, die nicht mehr den Blick aufs Wesentliche hinbekommt.
Bevor Sie den Artikel nicht zu Ende lesen und mich gleich wütend in die Ecke der „frauenfeindlichen Männer“ stellen, kann ich Sie beruhigen. Ich mag Frauen. Arbeite gerne mit ihnen zusammen. Bin gerne und glücklich verheiratet. Meine Haltung zu den Geschlechtern ist einfach: Gleichberechtigung und gleiche Rechte für alle — nur lasst mich bitte mit den ganzen Partikularinteressen in Ruhe. Und doch gibt es für mich durchaus auch nachvollziehbare Argumente, weswegen wir über einen reflektierten Sprachgebrauch diskutieren sollten — bevor ich zum meinem „Aber...“ bezüglich der ganzen Gender-Sprach-Debatte komme.
Am Anfang war das Wort
Dieser Satz stand schon in der Bibel. Worte haben eine unglaubliche Wirkung. Das habe ich schmerzlich gespürt, als ich an der European Business School studiert habe. Es handelt sich dabei um eine Privatuni und ich musste die Studiengebühren mit Hilfe eines Kredits finanzieren. Als ich während der Semesterferien ein Praktikum machte, um Geld zu verdienen – während meine Freunde an staatlichen Unis den Sommer und das Leben genossen – sank meine Motivation gegen Null. Ich schaute in den Kreditvertrag und lernte: wer schreibt der bleibt. Denn dort stand: Sollte dieses Studium aus welchen Gründen auch immer vorzeitig beendet oder abgebrochen werden, so ist dieses Darlehen innerhalb von 30 Tagen fällig.
Worte haben eine Bedeutung. Deswegen sollten wir sorgsam und achtsam unsere Worte wählen. Denn sie können für unseren Gegenüber schmerzhaft, verletzend oder diskriminierend sein.
Gleichberechtigung: es gibt Handlungsbedarf
Die Baustellen der Gleichberechtigung, auf denen wir als Gesellschaft Handlungsbedarf haben, scheinen groß zu sein. So gibt es immer noch Unterschiede in der Bezahlung von Mann und Frau. Sie liegen in Deutschland laut Statistischem Bundesamt bei 22 Prozent. Oder doch nur bei sechs Prozent? Die Statistiker nennen beide Zahlen. Und sind sich selbst nicht so sicher. Dazu schreibt das Statistische Bundesamt: „Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der bereinigte Gender Pay Gap möglicherweise geringer ausgefallen wäre, wenn weitere lohnrelevante Einflussfaktoren für die statistischen Analysen zur Verfügung gestanden hätten. So lagen beispielsweise zu den familienbedingten Erwerbsunterbrechungen keine Informationen vor.“
Da fällt mir nur der Leitsatz ein: Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Je nachdem, welche Meinung Sie haben, werden Sie auch die passende Statistik finden, die Ihren Standpunkt untermauert.
Gleichberechtigung: Ja! Aber bitte nicht übertreiben.
Die Gender-Diskussion, die ich in den Medien mitbekomme, sind häufig Wort-fokussiert. Doch was bringen politisch korrekte Worte, wenn die Taten völlig anders aussehen? Der deutsche Volksmund weiß schon lange: „Worte sind Zwerge, Taten sind Berge“.
Ich kann nicht verstehen, weswegen es für eine Frau wichtig ist, auf Formularen mit Kunde oder Kundin angesprochen zu werden. Entscheidend ist doch die Frage, wie wertschätzend sie vom Kundenberater behandelt wird. Von mir aus können alle Banken ihre Formulare ändern und überall „Kundin“ drauf schreiben. Für mein Selbstwertgefühl als Mann wäre das kein Nachteil. Eher würde ich mich fragen, ob die Bank zu viel freie Zeit hat, um über solche Kleinigkeiten nachzudenken.
In den Diskussionen höre ich oft die Forderung, dass es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau geben darf. Und deswegen bräuchten wir eine gleich-stellende Sprache. Doch warum wurden dann Frauen-Parkplätze eingerichtet? Mit diesem Begriff grenzen wir die Frau bewusst vom Mann ab. Handelt es sich etwa um Rosinenpickerei? Nach dem Motto: Ich will wie ein Mann behandelt werden. Aber wenn es für mich von Vorteil ist, dann darf ich als Frau wieder anders (= bevorzugt) behandelt werden.
Übertreibung führt zum Gegenteil
Aus Sicherheitsgründen verstehe ich, dass ein Frauenparkplatz nah am Ausgang liegt, mit Kameras bewacht wird. Aber die Frauen-Diskussion geht weit über das Sinnvolle hinaus. Die Forderung nach Kunde / Kundin-Formularen, gender-angepasster Nationalhymne und vielem mehr sind für mich absurd. Und sie sind auch für die Frauen gefährlich.
Bitte verstehen Sie mich richtig: Ich halte die Bewegung, Mann und Frau wirklich gleich zu berechtigen für sinnvoll und überfällig! Aber wenn dieser Kampf auf zu vielen Nebenkriegsschauplätzen ausgetragen wird, besteht die Gefahr, dass die sinnvolle Diskussion ins Lächerliche gezogen wird.
Wahrheit ist eine Linie
Wenn ich das Für und Wider einer gender-gerechten Sprache für mich abwäge, dann ist es so wie immer im Leben: es gibt keine einfachen Wahrheiten. Und vor allem keine Punktwahrheiten, im Sinne von „das ist richtig“ oder „das ist falsch“. Vielmehr ist Wahrheit eine Linie. Es gibt viele Wahrheiten, die irgendwie alle richtig sind.
So halte ich es für wichtig, über unsere Wort- und Sprachgewohnheiten nachzudenken. Aber bitte nicht überall und ständig. Denn worum geht es eigentlich? Nicht um die Worte, sondern um die Taten. Es geht nicht um Mann und Frau. Sondern darum, dass wir alle Menschen fair behandeln. Unabhängig von Geschlecht. Aber auch unabhängig von Nationalität, Hautfarbe, Hobbies, Sprache, ...! Es geht allgemein darum, dass sich nicht Dominanz ungefragt durchsetzt und die Zurückhaltenden erniedrigt. Für mich ist das Ziel der ganzen Gender-Thematik eine gesunde Streitkultur, in der wir hart in der Sache reden, und fair zum Menschen bleiben.
Die Voraussetzung für diesen gesunden Umgang miteinander ist Respekt. Das bedeutet, die Souveränität des anderen anzuerkennen, dass er anders ist, denkt, fühlt und handelt als ich. Gelebter Respekt ist das, was wir zwischen Mann und Frau brauchen. Und da reichen keine Worte. Die stehen schon in unserem Grundgesetz: Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Das was wir jetzt brauchen sind Menschen, die diesen Worten endlich Taten folgen lassen.
Aufgeben oder durchhalten - die Angst darf nicht entscheiden
Ich habe einen Freund, der sich monatelang über die Strukturen in einem Konzern, in dem er als Führungskraft arbeitete, beschwert hat. Irgendwann platzte ihm der Kragen und er hat sich selbstständig gemacht. Großartig! Den Mut muss man mit Ende 40 erstmal haben. Sechs Monate später. Ich erhielt eine SMS von ihm, die mich sprachlos machte...
Keine Zeit zum Lesen? Dann hören Sie einfach zu. Unten klicken oder iTunes besuchen.
Ich habe einen Freund, der sich monatelang über die Strukturen in einem Konzern, in dem er als Führungskraft arbeitete, beschwert hat. Irgendwann platzte ihm der Kragen und er hat sich selbstständig gemacht. Großartig! Den Mut muss man mit Ende 40 erstmal haben.
Sechs Monate später. Ich erhielt eine SMS von ihm: „Habe Job als Geschäftsführer bei Firma XY angenommen“. Er hat sich also wieder in einem Konzern anstellen lassen. Meine Antwort an ihn: „Du hattest den Mut, dich selbstständig zu machen. Aber den Mumm, durchzuhalten, wenn es hart auf hart kommt, hattest du nicht.“ Er: „Hört sich doof an, ist aber leider so.“
Hand aufs Herz: Wahrscheinlich geht es Ihnen so wie mir, dass auch Sie ins Zweifeln kommen, wenn es mal schwierig und zäh wird. Obwohl Sie sich etwas fest vorgenommen haben, spielen Sie mit dem Gedanken, aufzugeben. Und wahrscheinlich haben Sie auch schon ein Vorhaben abgebrochen, als es nicht so schnell, nicht so gut lief wie geplant. Doch es gibt Situationen, in denen Aufgeben leider keine Lösung ist, sondern nur das Problem verschärft …
Der Todesstreifen der Veränderung
Denken Sie mal zurück, als Sie das letzte Mal etwas angefangen und dann doch abgebrochen haben:
- das Tüfteln an einer Produktinnovation,
- ein Veränderungsprojekt im Unternehmen umsetzen,
- das Budget in der Firma endlich mal erreichen,
- Englisch lernen,
- Sport machen,
- die Beziehung mit Ihrem letzten Lebenspartner, von dem Sie sich trennten, als es nicht „rund“ lief
- oder der Neujahrsvorsatz endlich mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen ...
Es begann mit Euphorie und versickerte irgendwann still und heimlich im Tagestrubel. Und mit Sicherheit hatten Sie zahlreiche Gründe, Ihr einst so zielstrebiges Vorhaben abzubrechen.
So wie mein Freund, der seine Selbstständigkeit beendete, weil es zu hart, zu anstrengend war, alles zu langsam vorwärts ging und der Erfolg zu lange auf sich warten ließ – während die Miete und die Unterhaltszahlungen für seine Kinder sich immer enger um seinen Hals wickelten. Schließlich muss das Essen irgendwie auf den Tisch kommen. Ich könnte sogar fast verstehen, wenn Sie Verständnis für meinen Freund hätten – aber eben nur fast.
Zu Erfolg gehören zwei Dinge. Erstens, entscheiden. Zweitens, umsetzen. Zwar hadern Menschen immer mal wieder dabei, Entscheidungen zu treffen, aber den meisten fällt dieser erste Schritt doch vergleichsweise leicht. In einem Anflug von Motivation und Euphorie steht der Plan: Mehr Sport machen. Neues Veränderungsprojekt auf den Weg bringen. Englisch lernen.
Doch wenn Sie eine Entscheidung getroffen haben und sich dann auf den Weg der Umsetzung machen, lauert bereits der wahre Feind jeder Veränderung: das Tal der Tränen. Und genau hier ist mein Freund mit seiner Selbständigkeit kläglich verkümmert.
Aus meiner Erfahrung ist der alles entscheidende Faktor, ob Sie eine Entscheidung erfolgreich umgesetzt bekommen oder nicht, die Frage, ob Sie in der Lage sind, sich durch dieses Tal der Tränen durchzukämpfen. Ob Sie Ihr Ding konsequent durchziehen. Komme was wolle. Und diesen Mumm haben die meisten leider nicht. Sie bleiben im Tal der Tränen stecken und geben auf.
Mit angezogener Handbremse
Diesem Tal der Tränen ist jeder schon im Leben begegnet. Wenn ich Veränderungsprojekte in Unternehmen begleite, spreche ich viel mit den Mitarbeitern und Führungskräften. Dabei habe ich die Erfahrung gemacht, dass allein schon die Sorge davor, dass das Tal der Tränen kommt, die Menschen blockiert.
Es ist dieser Nebel, der auf dem Weg liegt, da keiner so genau weiß, was auf die Menschen zukommt. So entsteht Angst: die Angst vor den Konsequenzen der Veränderung. Sie fürchten sich vor den Problemen, die im Tal der Tränen kommen könnten, noch bevor sie überhaupt dort angekommen sind.
Sie haben Angst vor den Szenarien, die in der Zukunft passieren oder eben nicht passieren, Sie fürchten sich davor, nichts Erfüllendes am Ende Ihrer Reise zu finden, Sie haben Angst, beruflich nicht Fuß zu fassen. Kurzum: Sie haben Angst, der Zukunft nicht gewachsen zu sein. Und es scheint manchmal einfach leichter, umzukehren – den notwendigen Veränderungen auszuweichen und einfach im gewohnten Status Quo zu verharren. Aber das ist keine Option!
Mut bedeutet, dass Dir etwas anderes wichtiger ist, als Deine Angst
Aus meiner Erfahrung sind Frauen ehrlich: sie sagen, dass sie Angst haben. Männer umschreiben das: sie haben Respekt vor der Situation. Wie auch immer – ich kann Ihre Angst bzw. Ihren Respekt nachvollziehen, denn es ging mir genauso. Und zwar schon oft im Leben.
Am intensivsten habe ich diese Angst gespürt, als ich damals aus der Private Equity Firma ausgestiegen bin. Da war auf einmal kein Plan, kein gefüllter Kalender mehr, kein Horizont, wo die Reise hingehen soll. Und mich hat die Angst gepackt, die Angst vor der Zukunft. Was werde ich beruflich machen? Wie finde ich neue Kunden? Wie soll es weitergehen?
Die ersten Wochen ging ich nicht aufrecht, sondern taumelte eher vorwärts. Aber das ist das Entscheidende: Schritt für Schritt durch das Tal der Tränen weitergehen. Die Hindernisse verschwinden nicht, indem Sie stehen bleiben. Bei mir war das Leben mit Hindernissen sehr spendabel. Ich musste drüberklettern, sie überspringen oder sie durchbrechen. Trotz Angst, weitermachen. Egal wie – Hauptsache durch das Tal der Tränen kommen.
Wer fleißig ist, wird mit Glück belohnt
Anfangs suchte ich gierig nach der schnellen Lösung. Doch auf dem Weg lernte ich, mein Urvertrauen wieder zu gewinnen. Das Vertrauen, dass wir nicht alles immer steuern und kontrollieren können – sondern dass das Leben uns manchmal „von alleine“ den richtigen Weg weist. Indem der richtige Mensch, der richtige Gedanke, der richtige Moment plötzlich auftaucht und wir Kraft und Zuversicht gewinnen und gleich einen ganzen Satz nach vorne machen. Mir ist dieser Weg durch das Tal gelungen. Er war zwar nicht angenehm, aber rückblickend kann ich Ihnen sagen: Ich bin daran gewachsen. Und Sie werden das auch!
Im Prinzip haben Sie nur eine Wahl:
- Wenn in Ihrem Leben alles super ist – und Sie im Status Quo einfach sitzen bleiben, verwandelt sich Ihr Paradies irgendwann von alleine in ein Tal der Tränen – oder etwas derber, dafür aber konkreter gesprochen: in einen Haufen Mist. Die Firma will Sie auf einmal loswerden. Ihr wichtigster Kunde kündigt und wechselt zum Wettbewerber. Ihrer vernachlässigten Beziehung geht die Glut verloren und Ihr Partner flieht in eine Affäre. Die Digitalisierung rationalisiert Ihren Arbeitsplatz weg. Veränderungen sind unaufhaltsam. Sie kommen. Auch zu Ihnen.
- Wenn die Veränderungen schon zugeschlagen haben und Sie bereits im bildlichen Misthaufen sitzen, wo Sie alles ätzend und nervig finden oder es einfach nicht so läuft, wie Sie es gerne hätten, dann bleibt Ihnen nur der Aufbruch in die Veränderung. Doch der Weg zur Lösung führt Sie ins Ungewisse, wo jeder Schritt eine Veränderung, die unbekannte Folgen hat, bedeutet.
Kurzum: das Tal der Tränen gehört zum Lebensweg dazu. Also weichen Sie ihm nicht aus. Stellen Sie sich ihm!
Der Wunsch nach Spaß steht Zielen im Weg
Ein leichter Weg zu anvisierten Unternehmenszielen? Selbstverständlich. Alles, was Sie dafür brauchen, steht in jedem guten Managerhandbuch über Work 4.0, Empowerment und Co. Und das Allerbeste daran: Dieser Weg wird garantiert kinderleicht – egal, um welches Ziel es sich handelt.
Keine Zeit zum Lesen? Dann einfach hören...
Ein leichter Weg zu anvisierten Unternehmenszielen? Selbstverständlich. Alles, was Sie dafür brauchen, steht in jedem guten Managerhandbuch über Work 4.0, Empowerment und Co. Und das Allerbeste daran: Dieser Weg wird garantiert kinderleicht – egal, um welches Ziel es sich handelt. So jedenfalls die Botschaft vieler Ratgeber. Nicht verwunderlich, schließlich wollen wir Menschen Anstrengungen, wenn möglich, vermeiden – das Leben ist doch sowieso schon anstrengend genug.
Doch die Sehnsucht nach dem leichten Weg zum Erfolg ist nicht nur naiv – sondern vor allem gefährlich. Denn sie lässt uns das vermeiden, was zum Erfolg gehört wie Schatten zum Licht: Anstrengung, Konsequenz und Härte.
Ein Tischkicker führt nicht zum Ziel
Klar ist es angenehmer und für unser Gehirn geeigneter, Spaß zu haben. Und manchmal finden Sie sogar Abkürzungen auf dem Weg zu Ihrem Ziel, die vielleicht weniger mühsam erscheinen. Zumindest anfangs. Doch oftmals entpuppt sich die scheinbare Abkürzung als ein böser Umweg.
Ab und an halte ich Gastvorträge an Universitäten. Dort werden mir immer wieder Umwege als Abkürzung verkauft. Studenten erzählen mir, dass sie später einmal ein eigenes Unternehmen gründen, jedoch zunächst Erfahrungen in einem großen Konzern sammeln möchten. Als Angestellter.
Ich frage mich dann jedes Mal: Wie bitteschön soll jemand in einem hierarchischen System, das geprägt ist von Regeltreue, Gehorsam und Political Correctness, lernen, wie man als Unternehmer Regeln bricht und Innovationen vorantreibt? Die vermeintliche Abkürzung „Angestellter im Konzern“ stellt sich spätestens mit der eigenen Unternehmensgründung nur als unnötigen Umweg heraus.
Denn wie heißt es doch so schön: Im Leben bekommen Sie nichts geschenkt. Entsprechend sind Sie gefordert, Härte gegen sich selbst an den Tag zu legen.
Sonderlich verführerisch hört sich das nicht an, keine Frage. Da halten wir uns doch lieber an die Maxime: Spaß muss das Leben machen und natürlich auch die Arbeit. Und zwar sowohl Führungskräften als auch Mitarbeitern. Also wird hier ein Tischkicker im Unternehmen aufgestellt und dort eine Rutsche installiert – in der Annahme, dass durch diesen Fun die gemeinschaftliche Leistung verbessert wird. So ein Schwachsinn! Denn nur mit Spaß und Freude erreichen Sie niemals Ihre großen Ziele.
Ziele? Nichts leichter als das
Stattdessen bin ich der Überzeugung, dass große Ziele nur dann Realität werden, wenn wir uns mit Disziplin und Härte auf den Weg machen. Was bei diesem Vorgehen hart ist: dass Sie den Weg zu Ihrem Ziel fokussiert und konsequent durchziehen.
Als ich beispielsweise anfing, neben meiner Beratertätigkeit Vorträge zu halten, fand ich schnell Geschmack daran. Obwohl ich eigentlich keine Angestellten mehr haben wollte, brauchte ich jemanden, der sich um diesen neuen Bereich in meinem Leben kümmert. Also traf ich mich mit einem Bekannten aus alten Zeiten. Ich hatte ihn als absolutes Vertriebsass kennengelernt. Bei einem Abendessen fragte ich ihn: „Ich will meine Arbeit als Vortragsredner zu einer tragenden Säule ausbauen. Was ist wohl die beste Strategie, um das zu schaffen?“ Er überlegte nicht eine Sekunde. „TAM.“
Ich schaute ich verdutzt an. Er erklärte: „Tägliche Arbeits-Methodik. Einfach kontinuierlich neue Kontakte im Markt machen. Ich rufe jeden Tag 16 potenzielle Interessenten an. Plus Wiedervorlagen. Fünf Tage in der Woche, komme, was wolle. So generiere ich dir im Jahr rund 1000 Kontakte zu Leuten, die dich bisher noch nicht kennen.“ Alles klar, dachte ich. Das ist mein Mann. Fokussiert und konsequent. So wird das klappen.
Vom Schein zum Sein
Ich glaubte an meinen Bekannten, an seine Haltung und seine Disziplin. Ich glaubte an das Gesetz der TAM. Und ich gab ihm den notwendigen Freiraum, den er mit Verantwortung füllte. Er zog es durch. Und nach nur zwei Jahren generierte ich einen erheblichen Anteil meines Umsatzes durch Vorträge.
Dieses Beispiel machte mir nochmals sehr deutlich, dass es keinen Kuschelkurs zum Erfolg gibt. Es ist klar, dass Ihnen Ihr Thema Spaß machen sollte, so dass Sie mit Leidenschaft zur Sache gehen. Aber Menschen können nur dann etwas in ihrem Leben bewirken, wenn sie neben ihrer Leidenschaft auch konsequent vorwärtsgehen. Wenn sie den Preis zahlen, indem sie Hindernisse überwinden und fähig zur Härte im Umgang mit sich selbst, Problemen und Herausforderungen sind. Nur so bewirken sie etwas im Leben.
Die Belohnung wartet am Gipfel: Sie erreichen auf einmal Ihre Ziele. Da der Weg zum Ziel anstrengend war, wissen wir die Erfolge auch viel besser zu würdigen. Und dann, wenn Sie Erfolg haben, passiert etwas Magisches: die ganze Anstrengung macht auf einmal auch noch Spaß ;-)
Klartext kann man nicht in Watte verpacken
Überall zeigt sich das gleiche Symptom: der Gemocht-Werden-Wollen-Virus. Ich bin jedoch der Meinung, dass man Klartext nicht in Watte verpacken kann. Denn ...
Keine Zeit zum Lesen? Dann einfach im Podcast hören:
Egal ob auf Facebook, beim Mittagstisch mit Kollegen oder im Meeting mit dem Chef – überall zeigt sich das gleiche Symptom: der Gemocht-Werden-Wollen-Virus.
Dieser mentale Virus ist gefährlich, denn er verhindert, dass das gesagt wird, was notwendig ist. Direkte sachliche Ansagen? Fehlanzeige. Konstruktive ehrliche Gespräche? Pustekuchen. Stattdessen wird der Klartext in kleine, unbedrohliche Wort-Wattebäusche verpackt. Sie tun garantiert nicht weh, doch bewirken tun sie leider auch nichts.
Meinung verschluckt?
Ich hatte beispielsweise solch einen Fall mit dem Vorstand eines börsennotierten Unternehmens. Es ging um die Umsetzungsbegleitung einer neuen unternehmerischen Strategie. In vielen Punkten waren wir uns bereits einig und einer Zusammenarbeit stand nichts mehr im Weg. Doch eine Voraussetzung wollte ich vorher noch klären. Deswegen fragte ich: „Damit wir die gewünschte Kulturveränderung erfolgreich umsetzen, werden wir auch heikle Themen offen und direkt ansprechen müssen. Sind Sie offen für eine solch offene Streitkultur?“ Für mich zwar nicht immer eine angenehme, aber dennoch eine selbstverständliche Normalität. Für mein Gegenüber jedoch nicht: „Grundsätzlich bin ich dafür. Aber nur, wenn das alles in einem loyalen Kontext stattfindet.“ Für mich war mit diesem Satz die Sache erledigt, denn offene Streitkultur funktioniert nur offen, und nicht unter Voraussetzungen und Filterungen.
Weichgespültes Verhalten begegnet mir jedoch nicht nur im Büro. Denken Sie an ein Restaurant. Der Kellner fragt: „Hat es Ihnen geschmeckt?“. Wie oft kommt jetzt ein „Ja“ , obwohl ein „Nein“ der Wahrheit entspräche. Oder in der Schule beim Elternabend. Die Eltern stehen unter sich und lästern über den Lehrer. Als dieser den Raum betritt, herrscht Schweigen. Am Ende der Veranstaltung fragt er: „Gibt es noch Fragen?“ – und keiner traut sich, den Mund aufzumachen. Stattdessen freundliches Lächeln ...
Die vergessene Sehnsucht
Dabei haben Menschen eine innere Sehnsucht nach klaren Worten. Mein meistgebuchter Vortrag ist „Heikle Botschaften – unter Druck souverän bleiben“. Nachvollziehbar, denn jeder weiß, heikle Botschaften sind Teil des Lebens, ob Sie wollen oder nicht. Das liegt an einem einfachen Kreislauf: Veränderungen führen zu Problemen. Diese müssen gelöst werden. Und die entstandenen Lösungen führen wiederum zu Veränderungen – und diese zu neuen Problemen. Es ist ein nicht aufzulösender Kreislauf. Im Gegenteil: Er dreht sich immer intensiver, da die Veränderungen nicht nur schneller und häufiger geschehen, sondern auch immer schärfer werden. Entsprechend nimmt die Zahl und Intensität der Probleme zu. Folge: Heikle Botschaften sind unvermeidlich.
Ja, aber sprechen wir solche Botschaften nicht schon an? Klar, auf Twitter, Facebook, YouTube und Co. reißt jeder in der Anonymität den Mund auf. Doch im Gespräch face to face bleibt er geschlossen. Es ist schon irgendwie merkwürdig, denn wir kommunizieren immer mehr, doch eine wirkliche Streitkultur und Meinungsfreiheit herrscht dadurch noch lange nicht. Viel zu oft sorgen dominante Macht-Typen dafür, dass ihr Umfeld „politisch korrekt“ mit ihnen spricht und der notwendige Klartext fehlt. Wahrheit will zwar jeder, nur hören irgendwie nicht. Doch die ist in meinen Augen unabdingbar, damit wir als Einzelner und auch als Gesellschaft wirkungsvoll leben.
Streiten? Ja, aber richtig!
Dazu brauchen wir zwei Dinge. Einerseits Streit, im Sinne von, dass Meinungsverschiedenheiten offen ausgetragen werden. Damit das nicht in Sodom und Gomorra endet, braucht es andererseits eine gewisse Kultur. Denn in unserer heutigen Gesellschaft ist Streit negativ belegt und hat nichts mit dem ursprünglichen, wertfreien Austausch zu tun.
Deswegen müssen wir als Gesellschaft wieder lernen, eine Streitkultur zu leben, in der wir Konflikte konstruktiv angehen. Damit sich nicht nur Dominanz durchsetzt, sondern auch zurückhaltende Menschen in eine Diskussion einbringen können. Damit das Wort nicht mehr im Wattebausch verpackt ist, sondern wieder zu einer Meinung wird. Damit alle Beteiligten sich für die Sache einsetzen, ihre Position vertreten können, sich gleichzeitig aber auch die der anderen anhören können. Wir sind nunmal keine wilden Tiere, sondern bezeichnen uns selbst als Krönung der Schöpfung. Und die sollte im 21. Jahrhundert soweit gekommen sein, eine konstruktive Streitkultur zu leben, um gemeinschaftlich zu einer sinnvollen Lösung zu kommen.
Streitkultur ist für mich die beste Medizin gegen das Gemocht-Werden-Wollen-Virus. Und mal so unter uns: Wenn Sie den Mut haben, in entscheidenden Situationen den Mund aufzumachen, gewinnen Sie bei mir Respekt. Und mit dieser Meinung stehe ich garantiert nicht alleine da.
Wenn der Wegweiser keinen Weg mehr weist
Davonrennen, alles hinter sich lassen und nochmal ganz von vorne starten. Wie oft haben Sie sich das schon einmal vorgestellt? Wenn es im Job überhaupt nicht mehr läuft. Oder jegliche Leidenschaft in der Beziehung verloren ging und Sie einfach nur noch wegwollen. Dann beherrscht Sie ein Gefühl: Hauptsache weg hier!
Keine Zeit zum Lesen? Dann einfach den Podcast hören:
Davonrennen, alles hinter sich lassen und nochmal ganz von vorne starten. Wie oft haben Sie sich das schon einmal vorgestellt? Wenn es im Job überhaupt nicht mehr läuft. Oder jegliche Leidenschaft in der Beziehung verloren ging und Sie einfach nur noch wegwollen. Dann beherrscht Sie ein Gefühl: Hauptsache weg hier!
Emotional macht das vielleicht Sinn. Doch nehmen wir mal etwas Abstand: wäre das Leben wirklich auf einmal besser, wenn Sie einfach abhauen und einen Neustart wagen?
Eine neue Liebe, ist wie ein neues Leben
Mit diesem Song-Titel hat Jürgen Marcus sowas von recht. Und aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass es auch für den Beruf gilt. Dieses Gefühl, wenn Sie endlich diesen Schritt, diesen Cut, wagen: es ist pure Euphorie. Als ich damals noch in der Finanzbranche arbeitete, war ich irgendwann richtig unzufrieden. Rund zwei Jahre notierte ich mir, was mich stört, was sich ändern muss. Manchmal nehme ich dieses Heft zur Hand und bin immer wieder fassungslos, dass ich mich zwei Jahre lang mit meiner Unzufriedenheit gequält habe, bis ich endlich eine Entscheidung traf: „Ich muss da raus.“
Die Entscheidung, endlich die Situation zu verlassen, fühlte sich fast an wie „frisch verliebt“. Ich spürte Euphorie. Zunächst jedenfalls …
Die Stille, die Sie erdrückt
Denn als ich keine Beschäftigung mehr hatte, war da einfach ... nichts mehr. Ich verlor meinen sinnvollen Horizont, meine berufliche Richtung. Ich hatte plötzlich kein Büro mehr, in das ich fahren konnte, keinen Terminkalender, der von anderen gefüllt wurde. Da war auf einmal nur noch Stille.
Aus heutiger Sicht weiß ich: Wegrennen bringt Sie nicht weiter, wenn Sie keine Ahnung haben, wohin Sie eigentlich rennen wollen.
Die Hoffnung stirbt zuerst
Verstehen Sie mich bitte richtig: wenn im Leben etwas ganz gravierend schiefläuft und Sie so Ihre persönliche Integrität verletzen, ist es in meinen Augen jedermanns Pflicht, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und etwas zu ändern. Lebenszeit ist schließlich begrenzt – auch für mich, wie mir meine Tumorerkrankung am eigenen Leib deutlich gemacht hat.
Der Moment, in dem Sie also einen quälenden Job, eine nicht-erfüllende Beziehung oder ein sinnloses Projekt beenden, ist ohne Frage sinnvoll. Doch die Hoffnung, dass mit diesem Ende automatisch alles gut sein wird, verfliegt schnell. Denn eine falsche Richtung aufzugeben, bedeutet eben auch, genau wissen zu müssen, wo die neue Richtung hin verlaufen soll. Eine banale Erkenntnis, mit der ich damals nicht gerechnet habe.
Der kaputte Wegweiser
Ich stand damals plötzlich vor meinem inneren Wegweiser und hatte keinen blassen Schimmer mehr, wo ich nun hinlaufen sollte. Er zeigte mir keinen Weg an. Unweigerlich war es dann an der Zeit, mir endlich die entscheidenden Fragen zu stellen. Ich konnte mich nicht mehr vor mir selbst verstecken, wenn ich wieder eine Richtung haben wollte. Die Entscheidung „weg von etwas“ fällt eben leicht, ist aber leider nur die Hälfte der Miete. Viel entscheidender ist die Antwort auf die Frage: „hin zu was denn?“.
Was kann ich richtig gut? Womit kann ich anderen einen Nutzen stiften? Worin will ich der Beste werden, weil ich darauf einfach Lust habe? Bei mir kristallisierte sich nach und nach ein klares Bild heraus. Ich wollte mich nicht mehr verbiegen, merkwürdige Kompromisse machen oder mich mit den „falschen“ Themen und Menschen beschäftigen. Während meiner Zeit in der Finanzbranche hatte ich erlebt, wie kräftezehrend es ist, wenn man genau das alles falsch macht. Ich spielte jahrelang nach Regeln, die nicht meinen Werten entsprachen. Das wollte ich nicht mehr. Ich wollte etwas Sinnvolles tun. Etwas, mit dem ich für andere einen Nutzen stiften konnte.
Ich hatte so viele Menschen im Berufsleben kennengelernt, die in einem finanziellen Käfig gefangen waren: erfolgreich, aber unglücklich. Es geht nicht darum, glücklich oder finanziell erfolgreich zu sein. Die Kunst ist, beides zu erreichen. Und so bin ich heute dankbar, Menschen dabei zu helfen, einen sinnvollen Weg, eine neue Richtung für sich zu finden. Wirkungsvoll zu werden und Ergebnisse zu erzielen, für die es sich lohnt, sich anzustrengen. So wie ich es damals machen musste.
Und diese neue Richtung zu haben, war alle Mühe wert!
Weil Ihr Bett ein Gedächtnis hat
Wo haben Sie geheiratet? Wo waren Sie am 11. September? Wo feierten Sie einen großen Projekterfolg – oder bekamen eine Standpauke von Ihrem Chef? Ich bin mir sicher, Sie haben schlagartig die Bilder zu einer dieser Situationen vor Augen. Denn: Manche Dinge bleiben ewig im Gedächtnis. Und vor allem der Ort, an dem sie stattgefunden haben.
Weil Ihr Bett ein Gedächtnis hat
Wo haben Sie geheiratet? Wo waren Sie am 11. September? Wo feierten Sie einen großen Projekterfolg – oder bekamen eine Standpauke von Ihrem Chef? Wo fand Ihr erster Kuss statt?
Ich bin mir sicher, Sie haben schlagartig die Bilder zu einer dieser Situationen vor Augen. Denn: Manche Dinge bleiben ewig im Gedächtnis. Und vor allem der Ort, an dem sie stattgefunden haben.
(K)ein Ort für heikle Familienthemen
Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber bei uns zuhause ist er Esstisch einer der wenigen Orte, an dem wir uns als Familie regelmäßig und vollständig treffen. Und genau deswegen ist der Esstisch eine Art „heiliger“ Ort für mich. Heilig im doppelten Sinne: Hier haben Smartphones oder andere Dinge, die ablenken, beim Essen nichts zu suchen. Und: Hier diskutieren wir keine heiklen Themen.
Natürlich ist es irgendwie praktisch, wenn doch schon alle beim Abendessen zusammensitzen, gleich auch die Fünf in Mathe oder die vulgäre Ausdrucksweise des Teenagers zu thematisieren. Schlechte Noten und sonstige Vergehen haben am Esstisch jedoch nichts zu suchen. Sonst brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn die Teenager irgendwann ihre Teller nehmen und zum Essen lieber in ihr Zimmer verschwinden.
Ein befreundeter Geschäftsführer beherzigte den Gedanken und erzählte mir: „Für solche Gespräche zitiere ich meinen Sohn nun immer aufs Sofa. Vielleicht ist das der Grund, warum er seit Neustem vom Sessel aus Fernsehen schaut …“
Überraschungsangriff im Büro
Vielleicht scheint das private Esstisch-Thema für Sie übertrieben. Doch stellen Sie sich nun bitte eine Situation aus Ihrem Arbeitsalltag vor: Ihr Chef platzt unangekündigt in Ihr Büro und macht Sie rund. Oder er ruft Sie in sein Büro und kritisiert Sie dort aufs Schärfste oder bespricht mit Ihnen ein heikles Thema im Meetingraum. Was glauben Sie, wie Sie sich fühlen, wenn Ihr Chef das nächste Mal in Ihr Büro kommt, Sie zu sich ruft oder Sie in den Meetingraum bestellt?
Ob bewusst oder unbewusst, Sie rufen sich die alten Erlebnisse ins Gedächtnis und befürchten automatisch, dass es jetzt wieder Ärger geben könnte. Das verursacht Stress. Die Orte haben ein Gedächtnis und durch dieses Verhalten Ihres Chefs ist Ihr Büro auf einmal ein negativ behafteter Ort geworden. Dabei soll es doch ein kreativer Raum sein, in dem Sie gerne arbeiten und gute Leistung bringen.
Deshalb verkünde ich heikle Botschaften immer an einem Ort, an dem sich meine Mitarbeiter nicht regelmäßig aufhalten. Meist wähle ich den Besprechungsraum. Damit sie wissen, worum es geht, kündige ich das Thema vorher an. Denn wer seine Mitarbeiter im Dunkeln lässt, missbraucht unnötig seine Macht. Doch meine Mitarbeiter sollen keine Angst haben, sondern sich sicher fühlen, um ihr volles Potenzial zu entfalten.
Die Regeln des Ehebetts
Ich möchte nicht, dass meine heiligen Orte negativ belegt werden und ich möchte auch nicht die positiven Orte anderer Menschen mit einem schlechten Erlebnis belasten. Meine Frau und ich haben zuhause deswegen einen zweiten „heiligen“ Ort definiert: unser Ehebett. Es ist ausdrücklich nur für Dinge gedacht, die Spaß machen oder der Erholung dienen :-)
Früher gab es in den Ehen den sogenannten „Pillow-Talk“ (engl. pillow = Kissen): Vor dem Schlafen sprachen Mann und Frau über den Tag. Dieses Gespräch wurde zunehmend ersetzt durch Fernseher, Laptops und Smartphones. Doch eine Ehe braucht Austausch. Zwar haben wir keinen Fernseher im Schlafzimmer, aber Laptop und Smartphone haben auch bei uns Einzug erhalten. Um das Ehebett trotzdem heilig zu halten, berücksichtigen meine Frau und ich zwei Regeln:
Im Bett werden keine kritischen Themen besprochen – auch wenn es manchmal schwerfällt. Zweitens: Egal, was wir tun – wir beenden jeden Tag, indem wir abends im Bett gemeinsam den Satz „Gott schütze unsere Ehe“ sagen. Das machen wir sogar, wenn ich auf Reisen bin, dann eben via Telefon.
Rituale festigen
Sie können mich jetzt als zu weich oder als unverbesserlichen Romantiker abstempeln. Ich möchte mich auch gar nicht als Bilderbuch-Ehemann darstellen. Aber ich kümmere mich jeden Tag intensiv um meine Kunden -- und mir fällt bei bestem Willen kein Grund ein, warum ich mich nicht auch jeden Tag intensiv um meine Ehe kümmern sollte. Deshalb halte ich es auch für richtig, dafür zu sorgen, dass meiner Frau und mir positive Orte im Gedächtnis bleiben.
So besuche ich an jedem Hochzeitstag mit meiner Frau den Ort unserer Trauung und ich wiederhole meine Frage: „Willst Du meine Frau sein?“ Sie sagte mir anfangs, dass sie das eigentlich nicht braucht – aber es gefällt ihr. Und so geben wir uns durch Rituale Kraft und fokussieren unsere Aufmerksamkeit auf das, was uns wirklich wichtig ist – an unseren heiligen Orten.
Welche Orte sind Ihre heiligen Orte? Vielleicht achten Sie in Zukunft mehr darauf, wie Sie sich dort verhalten …
Rettungsanker im Tornado: Raus aus der Beschäftigungswut
Obwohl Sie den ganzen Tag fleißig ein To-do nach dem nächsten abarbeiten, füllt sich die Liste erbarmungslos. Das Schlimmste: ...
Obwohl Sie den ganzen Tag fleißig ein To-do nach dem nächsten abarbeiten, füllt sich die Liste erbarmungslos. Das Schlimmste: Der ganze Kram macht Ihre Ehe nicht romantischer und die Beziehung zu Ihren Kindern nicht inniger. Sie sind in einem Tornado gefangen.
Warum Sie rechtzeitig nach dem Rettungsanker greifen und Ihre täglichen Aufgaben gründlich überdenken sollten, lesen Sie in der Leseprobe meines Buches „Mut braucht eine Stimme“, die exklusiv bei FOCUS Online erscheint.
Wettbewerbsvorteil Streitkultur
Das Geschäft ist über die Jahre etabliert. Die Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kunden funktionieren gut. Erfolg ist schön. Und gleichzeitig gefährlich ...
Das Geschäft ist über die Jahre etabliert. Die Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kunden funktionieren gut. Erfolg ist schön. Und gleichzeitig gefährlich. Denn man versumpft darin gerne. Das Tagesgeschäft hält Sie mit dringenden Problemen auf Trab, so dass Sie sich nicht mehr die wirklich wichtigen Fragen stellen. Die Menschen sehen keinen Grund, etwas zu verändern: es läuft ja schließlich alles. Doch irgendwann kommt plötzlich der Tag, an dem es einen erwischt: der Wandel schlägt brutal zu und setzt uns auf einmal unter Handlungsdruck. Zum Glück gibt es einen schlaueren Weg.
>> zum Artikel
Den Artikel habe ich für das Verbandsmagazin „Technischer Handel“ geschrieben.
Der Krebs zeigte mir, was ich wirklich machen will
Die Karriereleiter läuft eben nicht immer steil nach oben — vor allem dann nicht, wenn das Schicksal zuschlägt. Im Beitrag erzähle ich, wie es mir nach meiner Krebserkrankung gelang, einen Cut in meinem Leben zu machen und mit neuer Klarheit durchzustarten.
Dieser Beitrag ist ursprünglich bei XING Klartext veröffentlicht worden.
Ihre Lebenszeit ist begrenzt – ja, das haben Sie schon tausendmal gehört. Und ja, das klingt kitschig und abgedroschen. Aber: Schauen Sie mal auf die vergangene Woche, den vergangenen Monat Ihres Lebens. Mit welchen Menschen haben Sie Zeit verbracht? In welchen Meetings saßen Sie? Mit welchen Themen haben Sie sich beschäftigt, und wofür haben Sie sich privat engagiert?
Waren das alles sinnvolle Themen und Menschen, mit denen Sie gern Zeit verbringen? Wenn es Ihnen geht wie mir vor meiner Erkrankung, dann antworten Sie vermutlich: Nein, da waren ein paar Tätigkeiten und Menschen dabei, die ich am liebsten aus meinem Kalender gestrichen hätte.
Die Lektion eines Besuchers
Ich habe zwei Anläufe gebraucht, um endlich ehrlich zu mir selbst zu sein. Nach meiner ersten Tumordiagnose mit anschließender Operation rutschte ich wie automatisch zurück in meinen Managementposten in der Finanzbranche – obwohl er mich schon seit zwei Jahren beruflich unzufrieden machte. Aber die Lektion des Lebens ließ nicht locker, es folgte eine weitere OP. Noch einmal die Sorgen, noch einmal die Angst. Doch diesmal kam eine neue Angst hinzu: Die Operation in der Schilddrüsenloge sorgte nun für die Gefahr, dass ich meine Stimme verlieren könnte. Dieses Mal brach mich die Krankheit – zum Glück, muss ich heute sagen. Denn während ich darüber nachdachte, wie es wäre, meine Stimme zu verlieren, begann ich endlich, auf meine innere Stimme zu hören.
Ich erkannte, dass meine Krankheit mir zwei Optionen zur Wahl gab: Ich konnte mich fortan als Opfer fühlen und seelisch an meinem Schicksalsschlag zugrunde gehen. Oder ich konnte in der Krankheit einen Besucher sehen, der in meinen Körper gekommen war, um mir eine Lektion zu erteilen – ein unbequemer Besucher, aber ein wohlgesonnener. Also hörte ich auf meine innere Stimme und lernte meine Lektion.
Klarheit ohne Wenn und Aber
Beruflich bedeutete das für mich einen vollkommenen Bruch. Raus aus dem Job, in dem ich mich verbog. Raus aus dem Umfeld, in dem meine Kollegen völlig andere Werte lebten als ich. Selbstverständlich meldeten sich da Bedenken: „Wie verdiene ich morgen mein Geld? Womit verbringe ich nun meine Zeit?“ Doch diese Einwände waren letztlich nichts als Ängste – und dafür ist mir meine Lebenszeit zu schade.
Beruflich stellte ich mich völlig neu auf. Gründete eine Firma und definiere nun allein, nach welchen Maßstäben ich arbeite. Seither zählt in erster Linie nicht das Geld, das ich als Businesscoach verdiene, sondern das Projekt und das Unternehmen selbst. Ich investiere meine Lebenszeit nur noch in Aufträge, bei denen ich das Gefühl habe: Hier kann ich ganz sicher einen Nutzen, einen Mehrwert stiften – egal ob es sich bei dem Klienten um ein Start-up, einen großen Konzern oder einen Manager handelt. Das tue ich dann auch ohne Wenn und Aber, spreche heikle Botschaften aus und sage Unternehmern sehr direkt, wenn in ihrem Betrieb etwas schiefläuft. Das Argument „gute Bezahlung“ zählt nicht mehr, wenn es bedeutet, sich dafür im Job zu verbiegen und Konzernchefs Honig um den Mund zu schmieren.
Das, was wir tun, sollte mit unseren Werten übereinstimmen
Ich glaube, diese Klarheit, für das zu stehen, was man tut, ist essenziell – nicht nur im Umgang mit anderen, sondern vor allem auch mit uns selbst. Denn ja, unsere Lebenszeit ist begrenzt. Also sollte das, was wir in ihr tun, doch zumindest einhergehen mit unseren Werten und unserer inneren Haltung.
Dazu gehört auch, sich hin und wieder abzugrenzen. Zu selektieren, wo und in wen Sie Ihre Lebenszeit investieren oder lieber nicht. Den Mund aufzumachen und unbequem zu sein. Denn das ist allemal besser, als am Ende dazustehen und zu bedauern, dass man nicht den Mut hatte, seinen eigenes Leben zu leben.
Mut zur Lebensführung
Wie Sie in einer unsicheren Welt selbstbestimmt bleiben — oder es endlich werden
Der Wandel ist scharf. Und die Zukunft unsicher. Es braucht Mut zur Lebensführung, um am Ende sagen zu können: Mein Leben war selbstbestimmt und erfüllend.
Mehr dazu erfahren Sie in meinem neuen Buch. Es erscheint im September 2021. Sie können es bereits jetzt vorbestellen — überall, wo es Bücher gibt.
WORUM ES GEHT
Lassen Sie uns das Stärkste unternehmen, was uns möglich ist: Gegenwart machen. Um beruflich wie privat wirkungsvoll zu sein und ein erfülltes Leben zu führen. Im Blog finden Sie dazu geistige Reibungsfläche. Viel Freude beim Lesen.
THEMEN
BÜCHER
DIGITALE FORTBILDUNG
Umsetzungs-orientierte Online-Trainings stehen Ihnen rund um die Uhr zur Seite, damit Sie wirkungsvoller werden.