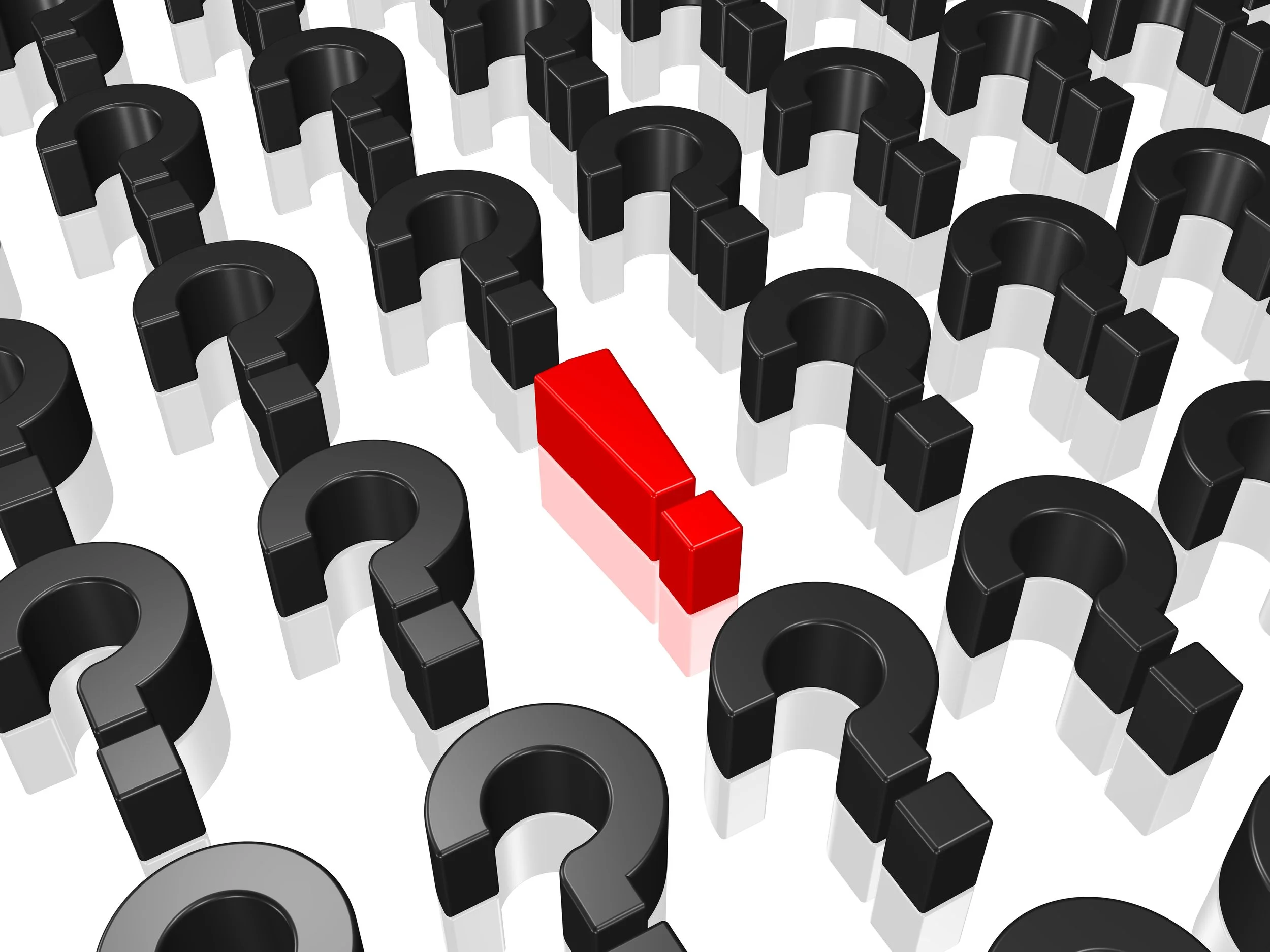HOLZERS HORIZONTE
Der Sinn des Lebens: Reich werden
Das moderne Leben bietet uns ungeahnte Möglichkeiten. Selbstredend, dass der Erfolg immer schnell kommen muss. Neue Geschäftsmodelle beweisen sich innerhalb von 100 Tagen. Der richtige Lebenspartner für eine erfüllte Beziehung ist nur einen Wisch entfernt. Und überhaupt ist es für jeden machbar, in ein paar Jahren zum Millionär zu werden. Man muss nur einem der Gurus ausreichend Geld in den Rachen werfen und dann verrät er die Abkürzung zum finanziellen Glück. Ich bin überrascht, wie viele Menschen sich wie dumme Schafe verhalten und auf all den Mist reinfallen.
Das moderne Leben bietet uns ungeahnte Möglichkeiten. Selbstredend, dass der Erfolg immer schnell kommen muss. Neue Geschäftsmodelle beweisen sich innerhalb von 100 Tagen. Der richtige Lebenspartner für eine erfüllte Beziehung ist nur einen Wisch entfernt. Im Internet mal eben ein paar Tausend Euro nebenher verdienen. Und überhaupt ist es für jeden machbar, in ein paar Jahren zum Millionär zu werden. Man muss nur einem der Gurus ausreichend Geld in den Rachen werfen und dann verrät er die Abkürzung zum finanziellen Glück. Ich bin überrascht, wie viele Menschen sich wie dumme Schafe verhalten und auf all den Mist reinfallen.
Nach meinem Abitur wollte ich unbedingt an der EBS Universität studieren. Als älteste private Wirtschaftsuniversität in Deutschland stellte sie mich jedoch vor ein Problem: mir fehlten rund 50.000 Euro, um das Studium zu bezahlen. Da meine Eltern keine Bonzen waren, lernte ich die erste wichtige Lebenslektion: Probleme sind dazu da, um gelöst zu werden.
Rückblickend bin ich überrascht, dass es damals wirklich eine Bank war, die mir ein Darlehen angeboten hat. Und zwar ohne Sicherheiten. Und mit einem erfreulich kurzen Kreditvertrag. Er hatte nämlich nur 1,5 Seiten.
Es näherten sich die ersten Semesterferien und ich war auf der Suche nach einem bezahlten Praktikum. Ich brauchte nämlich Geld, um mein Leben zu finanzieren. Dieses Gefühl war irgendwie komisch. Geld motivierte mich, in den Semesterferien mit profilneurotischen Beratern von morgens früh bis abends spät im Großraumbüro beim Kunden zu hocken – anstatt das studentische Leben mit Musik, Party und Lebenslust zu genießen.
So schwor ich mir: Geld darf nie wieder ein Sorgenthema sein!
Der Sinn des Lebens
Wenn ich heute mit Unternehmern in meinen Coachings darüber spreche, was sie aus Ihrem Leben machen wollen, werden das meistens intensive Diskussionen. Jeder hängt voll im Tagesgeschäft drin, das einem Laufband gleicht, bei dem die Geschwindigkeit immer höher gedreht wird. Fürs Träumen oder das Nachdenken über den Lebenssinn bleibt da kaum Zeit. Und in unseren Gesprächen merken sie: wenn wir uns dann die Zeit zum Nachdenken nehmen, fällt es uns komischerweise verdammt schwer, zu definieren, was wir eigentlich aus unserem Leben machen wollen.
So ging es mir als Student auch. Und da habe ich es mir – wie viele andere Menschen auch – einfach leicht gemacht. Wenn Du keinen Lebenssinn hast, dann ist der Sinn des Lebens: reich werden.
Gefährlicher Irrglaube
Nach meinem Studium begann ich also meine Karriere dort, wo es sich rund um die Uhr um Geld dreht: in der Finanzbranche. Als Verantwortlicher für den Vertrieb eines Private Equity Fonds jagte ich förmlich Geld. Und es kam dann auch. In meinem Fall hatte der Erfolg jedoch seinen Preis.
Ich sagte damals zwar, meine Familie ist mir das Wichtigste. Mein Verhalten zeigte aber etwas anderes. Denn ich verbrachte mehr Nächte in Hotelbetten als Zuhause. Und so hatte ich eine Ehefrau, die vor Einsamkeit fror. Die „Gaga“-Jahre mit meinem Sohn hatte ich mehr oder weniger verpasst. Und dann war ich auch noch unzufrieden mit meinem Job, da meine Partner andere Vorstellungen über die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens hatten als ich. So verlor ich den Glauben an die Idee. Keine guten Voraussetzungen, um beruflich erfüllt zu sein.
Trotz all dieser Unzufriedenheit lief ich weiter dem Geld hinterher. Geld ist wie eine Droge. Es ist eben nie genug.
Ich brauchte damals einen Tritt in den Hintern. Den bekam ich mit der Diagnose Schilddrüsen-Krebs. Keine leichte Kost. Aber eine wirksame. Den Krebs habe ich besiegt. Und meinem Leben dann eine neue Richtung gegeben.
Der reichste Mann der Welt
Kürzlich habe ich mit meiner Frau den Film „Alles Geld der Welt“ gesehen. Er handelt von Jean Paul Getty, der seinerzeit der reichste Mensch der Welt war. Sein Enkel wurde in Rom entführt. Doch Getty weigerte sich, das Lösegeld zu zahlen, da er die Entführung für eine Finte hielt. Als seinem Enkel ein Ohr abgeschnitten wurde, zahlte er schließlich doch das Lösegeld.
Die Entführer forderten 3 Mio. Dollar. Medien berichteten, dass Getty jedoch nur 2,2 Mio. Dollar zahlen wollte. Der Grund ist erschütternd: die 2,2 Mio. waren der Höchstbetrag, den er steuerlich geltend machen konnte. Die restlichen 800.000 Dollar musste sich sein Sohn (Vater vom entführten Enkel) mit 4% Zinsen von Getty leihen.
Der Film wirft ein sehr mitleidserregendes Licht auf den reichen Getty. Er schwimmt zwar im Geld. Aber mehr als sein Geld und sein Besitz zeichnet ihn auch nicht aus. Während ich den Film sah, schwankten meine Gefühle zwischen Mitleid und Verachtung. Geld als einziger Lebenssinn ist für mich auf jeden Fall wertlos.
Schafherden und Brüllaffen
Keine Frage: in einer kapitalistischen Welt ohne Geld zu leben, ist Mist. So ist es verständlich, dass für viele Menschen Reichtum und finanzielle Freiheit wichtige Lebensziele sind. Mit viel Geld macht das Leben mehr Spaß.
Doch da viele Menschen diesen Zustand noch nicht erreicht haben, ist der Boden wie gemacht für die menschlichen Brüllaffen. Sie suggerieren, dass finanzieller Wohlstand ein Geburtsrecht für jedermann sei. Du schaffst es, wenn Du nur willst! Und der Weg ist so einfach und er kann so schnell gegangen werden, wenn Du nur weißt, was die notwendigen Schritte sind. Diese sind natürlich „geheim“. Aber sie werden auf teuren Seminaren und Coachings verraten.
Und so pilgern die Menschen wie Schafe zu den Brüllaffen und wundern sich, dass am Ende zwar die Brüllaffen die fette Beute gemacht haben – nur sie selber hängen noch in den Herausforderungen des Alltags gefangen. Denn die wahre Kunst ist nicht, den Weg zu kennen, sondern den Weg auch tatsächlich zu meistern. Wissen reicht eben nicht. Sie müssen es auch tun. Und dazu gehören im Wesentlich einfach nur Konsequenz und Disziplin.
Der wahre Reichtum für jeden von uns
Im Vaterunser heißt es: „Unser tägliches Brot gib uns heute“. Wir beten nicht: „Gib mir über Nacht so viel Brot, dass ich nie wieder welches besorgen muss“. Merkwürdig also, dass viele Menschen trotzdem dem unerschöpflichen (finanziellen) Brot hinterherlaufen und dafür Dinge aus den Augen verlieren, die sie vielleicht für immer verlieren.
In meinem Buch „Mut braucht eine Stimme“ zitiere ich Bronnie Ware, eine australische Palliativmedizinerin. Sie hat mit vielen Menschen zu tun, die an ihrem Lebensende angekommen sind. Sie fragte sie: Was bedauerst Du am meisten?
Sie ahnen es wahrscheinlich schon: Geld gehört nicht zu den Antworten. Stattdessen bedauern die Menschen dies:
Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben.
Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet.
Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken.
Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit Freunden und Familie verbracht.
Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein.
All diese Dinge haben eines gemeinsam: Sie können sie für Geld nicht kaufen.
Ich habe damals, nachdem ich den Krebs besiegt habe, meinem Leben eine neue Richtung gegeben. Also mit dem ersten Punkt von Bronnie Ware’s Liste angefangen: den Mut aufgebracht, mein eigenes Leben zu leben.
So bin ich aus der Finanzbranche ausgestiegen und habe beruflich nochmal völlig neu angefangen. Das war mit starken, finanziellen Einbußen verbunden. Aber das ist nichts, was einen umbringt. Im Gegenteil. Sie wissen ja: Probleme sind dazu da, dass wir sie lösen. Und daran wachsen wir. Das nennt man dann Erfahrung.
Dann habe ich um meine Ehe gekämpft und meine Frau um eine zweite Chance gebeten. Sie hat sie mir zum Glück gegeben.
Heute strebe ich nicht nach finanzieller Freiheit, sondern nach selbstbestimmter Zeit. Die Ironie ist, dass ich mittlerweile mehr verdiene als damals, als ich noch verbissen hinter der Kohle herlief.
Ich investiere meine Zeit in die gemeinsam geteilten Momente mit meiner Familie. Das kann ein Urlaub sein. Es können aber auch einfach nur gute Gespräche, ein Ausflug mit dem Sohn oder ein Spaziergang mit meiner Frau sein.
Das Schöne ist, dass diese Art von Wohlstand wirklich jeder von uns erreichen kann. Und dieser Wohlstand ist es auch, der die Welt zu einem guten Ort macht. Liebe und Mitgefühl sind die Basis für unseren Weltfrieden. Das Weihnachtsfest ist dazu eine schöne Gelegenheit, diese Art von Reichtum mit unseren Liebsten zu genießen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein reiches Weihnachtsfest voller Liebe und Mitgefühl. Und für das kommende Jahr eine heitere Gelassenheit und entspannten sportlichen Ehrgeiz, damit Ihr tägliches (finanzielles) Brot Ihren emotionalen Frieden versüßt.
Auf Ihre Kommentare (weiter unten unter dem Text) freue ich mich. Und wenn Ihnen der Beitrag gefällt, helfen Sie mir, dass er seinen Weg in die Welt findet. Also teilen erlaubt :-)
>> Zur Übersicht aller Blog-Beiträge
Arbeit ist keine Wellness-Oase
In unserer modernen Welt sind die Menschen so sehr beschäftigt, dass sie vor lauter komplizierter Komplexität die einfachen Banalitäten aus den Augen verlieren. Darunter leiden dann meist sowohl Mitarbeiter als auch Kunden. Eine entscheidende Banalität ist für mich die Frage: Was ist überhaupt Arbeit?
In unserer modernen Welt sind die Menschen so sehr beschäftigt, dass sie vor lauter komplizierter Komplexität die einfachen Banalitäten aus den Augen verlieren. Darunter leiden dann meist sowohl Mitarbeiter als auch Kunden. Eine entscheidende Banalität ist für mich die Frage: Was ist überhaupt Arbeit?
Leg' Dich mit dem Kunden an
Meine Frau begleitete mich kürzlich, als ich geschäftlich in Regensburg zu tun hatte. Fußläufig vom Hotel befindet sich ein kleiner Italiener mit hausgemachter Pasta und leckeren Pizzen. Ich kenne den Laden, weil ich dort jedes Mal esse, wenn ich in der Stadt bin. Und so sitzen wir in der kleinen Trattoria und essen zu Abend. Doch meine Pizza Spinaci schmeckt irgendwie komisch - und zwar nach Fisch.
„Das kann nicht sein. Liegt bestimmt nur daran, dass der Spinat seinen Geschmack beim Backen verändert hat“, denke ich. Mit jedem Biss kämpfe ich mich weiter. Dann frage ich meine Frau. Sie lacht mich erst aus, probiert und verzieht dann das Gesicht: „Das schmeckt nach Fisch!“
Wir rufen die Kellnerin. Sie sagt: „Das kann nicht sein, aber ich kläre das für Sie“. Noch bin ich motiviert, die volle Rechnung zu bezahlen. Fehler können ja jedem Mal passieren. Die Kellnerin kommt zurück: „Ich habe mit dem Koch gesprochen und die Zutaten in der Küche probiert. Das kann kein Fisch sein.“
Ich schlage ihr vor: „Wenn Sie mögen, probieren Sie doch einfach den Spinat hier.“ Sie tut es: „Das schmeckt wirklich nach Fisch!“ Ich fühle mich nun ein bisschen verärgert und frage nach der Rechnung. Sie antwortet: „Gerne, aber am Preis kann ich leider nichts machen“.
Ich war bis vor einem kurzen Augenblick noch willens, die vollständige Rechnung zu bezahlen. Doch nachdem sie nun selber den Fischgeschmack identifiziert hat, habe ich dazu keine Lust mehr und schlage ihr vor, den Betrag um 5 Euro zu kürzen. „Das darf ich nicht“ ist ihre Antwort. Worauf ich sie nach ihrer Chefin frage.
Mittlerweile komme ich mir vor wie bei „Verstehen Sie Spaß“ und bin ärgerlich-amüsiert. Der Hammer kommt aber noch: die Chefin erscheint mit einem Topf voller frischem Spinat. „Probieren Sie. Der schmeckt nicht nach Fisch“. Ich: „Das mag sein, dass er nicht nach Spinat schmeckt. Aber der auf meiner Pizza tut es.“ Sie: „Das kann nicht sein“. Ich: „Also sagen Sie, ich lüge... Probieren Sie doch.“ Aber das wollte sie nicht.
Es war wirklich eine filmreife Szene - und das Verhalten der Kellner hat dazu beigetragen, dass ich von „ich zahle die Rechnung vollständig“ abgerutscht bin zu „Scheißladen! Ich zahle die Pizza gar nicht“.
Die Kellnerin verschwindet schimpfend. Kürzt die Rechnung dann doch um meine Pizza. Und verhält sich in einer Art und Weise, dass ich sie fristlos gefeuert hätte, wenn es mein Laden gewesen wäre. Gerade in einer zunehmend digitalen Welt ist Service der entscheidende Teil unserer Arbeit. Und sie hat anscheinend noch nicht verstanden, worum es bei Arbeit eigentlich geht.
Der Kern der Arbeit
In meinen Veränderungsbegleitungen in Familienunternehmen frage ich die Mitarbeiter häufig eine banale Frage: „Was verstehen Sie eigentlich unter Arbeit?“
Versuchen Sie es doch auch gleich mal: Formulieren Sie Ihre Definition von Arbeit in einem Satz, so als würden Sie dies für ein Lexikon aufschreiben.
Wenn Sie Ihre Kollegen und Vorgesetzte fragen, werden Sie überrascht sein, wie vielfältig die Definition eines so banalen Begriffs wie Arbeit ausfallen kann. Dabei zeigen sich häufig die Auswirkungen eines groben Fauxpas, der sich in unserer Alltagssprache breit gemacht hat. Dort heißt es: „Morgens fahre ich ZUR Arbeit“. Demnach ist die Arbeit ein Ort, an den wir fahren.
Das traf im Zeitalter der Industrialisierung zu, als Menschen an Maschinen in Fabriken arbeiteten - und es gilt heute für einige Berufszweige nach wie vor. Doch für die meisten Büro-Arbeiter ist Arbeit kein Ort. Ihre Tätigkeit besteht vornehmlich aus Denken. Und das findet überall statt: beim Duschen, im Auto, am Strand, ...
Mir ist es am liebsten, wenn wir die Dinge einfach, pragmatisch und vor allem mit gesundem Menschenverstand anpacken. Insofern könnte Ihnen mein Verständnis von Arbeit zu banal klingen, aber es bringt für mich den Kern von Arbeit auf den Punkt:
Arbeit ist eine Tätigkeit,
mit der Sie für Ergebnisse sorgen.
Demnach sind Windelwechseln oder Gartenhecke-Schneiden genauso Arbeit wie Marketing-Kampagne entwickeln oder Change-Projekt aufsetzen. Die Kellnerin im Regensburger Italiener hat zwar durch ihre Tätigkeit auch für ein Ergebnis gesorgt: nämlich einen unzufriedenen Nie-mehr-wieder-Kunden gewonnen. Aber das ist natürlich nicht die Qualität von Ergebnissen, um die es geht. Für solche „Kindergarten-Fälle“ müssen wir die Definition von Arbeit also wahrscheinlich noch weiter präzisieren: eine Tätigkeit, mit der Sie für erfolgreiche Ergebnisse sorgen.
Beschäftigt, aber nicht produktiv
Der Mythos, dass Arbeit ein Ort ist, wird in vielen Unternehmen heute nicht nur am Leben gehalten, sondern überstrapaziert. Tischkicker, Erlebnisküchen und Kuschelecken werden aufgebaut. Massagestühle und Yoga-Matten sorgen für das körperliche Wohl. 360-Grad-Feedbacks, Motivations-Tschaka und Führungsleitlinien, die niemand liest und schon gar keiner lebt, stellen sicher, dass es zumindest pro forma gut aussieht.
Es werden im weitesten Sinne fragwürdige Wellness-Programme in den Unternehmen aufgesetzt, die dafür sorgen sollen, dass sich alle wohl fühlen. Kaffee-Vollautomaten ziehen in Heerscharen in die Unternehmen ein und 6-stellige Beträge werden im Jahr für Kaffee ausgegeben (pro Unternehmen wohlgemerkt). Und wenn es um den Kern des Unternehmens, die Arbeit, geht, sind dennoch viele Mitarbeiter und Führungskräfte nur beschäftigt – aber nicht produktiv.
Sie fahren abends frustriert nach Hause, weil sie das Gefühl haben, es hat sich an den entscheidenden Stellen nichts bewegt. Sie haben zwar viel gerödelt, aber leider keine sinnvollen Tätigkeiten verrichtet. Und das frustriert auf Dauer. Vor allen Dingen, wenn Sie dann auch noch Ärger bekommen, dass Sie vor lauter Tagesgeschäft-Unsinn nicht dazu gekommen sind, die wirklich wichtigen Veränderungen voranzutreiben.
Das liegt nicht daran, dass die Angestellten alles falsch machen. Im Gegenteil: es handelt sich um ein Führungsproblem. Viele Führungskräfte sind auf Grund fachlicher Qualifikation aufgestiegen, haben jedoch Führung nie gelernt. Durch ihr schwaches Führungsverhalten sorgen sie dafür, dass in den Unternehmen Beschäftigungs-Wut anstatt Produktivitäts-Euphorie herrscht.
Für viele fühlt es sich abends auf dem Sofa an, wie beim letzten Umzug: es wurden zwar schon unendlich viele Kisten in den Transporter getragen, aber irgendwie wird das Haus nicht leerer. Es hilft eben nichts, wenn man Unternehmen zu Wellness-Oasen umbaut. Wir müssen für Ergebnisse sorgen.
Output statt Input
Befeuert wird dieses Beschäftigsein auch noch von dem, was ich in meinem Buch den Input-Virus nenne. Wer davon infiziert ist, dem ist die Aktivität wichtiger als das Ergebnis.
Zahlengesteuerte CEO‘s bekommen zum Beispiel Angst, wenn die Zahlen hinter Plan liegen. Ihre Reaktion: Druck machen. Die Folge: Angst und blinder Aktionismus in den Teams. Ob das die wirklich sinnvollen Maßnahmen sind, weiß keiner. Weil sich niemand die Zeit für eine saubere Problemdiagnose nimmt.
Every No is the chance to say Yes,
when it really matters.
Das Vademekum gegen diese Beschäftigungswut ist das Wort „Nein“. Seien Sie radikal:
lehnen Sie Meeting-Einladungen ab,
nehmen Sie keine Projekte an, solange sie mit den bestehenden noch voll ausgelastet sind,
wenn der potentielle Mitarbeiter Sie in den Bewerbungsgesprächen nicht 100%-ig überzeugt hat, stellen Sie ihn nicht ein — und wenn Sie es doch getan haben, kündigen Sie ihm,
arbeiten Sie nur mit Kunden zusammen, die zu Ihnen passen (flapsig formuliert: „auf die Sie Bock haben“)
trennen Sie sich von Ihrem Lebenspartner, wenn er sie immer wieder schlecht behandelt und den Versprechungen keine Verbesserungen folgen
treffen Sie sich nur noch mit echten Freunden und werfen Sie die ganzen „Bekanntschaften“ aus Ihrem privaten Kalender, wenn Sie das Gefühl haben, für nichts mehr Zeit zu haben
Erfolg - beruflich wie privat - ist für mich erstmal eine Frage der Haltung. Nur wenn ich eine klare Haltung habe, kann ich auch konsequent in meinen Verhaltensweisen werden. Prüfen Sie einfach mal selber: Was ist Ihr Verständnis von Arbeit? Für welchen Output (= Ergebnis) wollen Sie sorgen? Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, um den richtigen Input (= Aktivität) zu finden?
Die gute Nachricht: eine Abkürzung gibt es immer. Sie müssen nur den Mut haben, den Umweg des Nachdenkens zu gehen. Doch Vorsicht: wenn Sie einmal eine neue Klarheit gewonnen haben, ist sie da. Und Sie müssen dann auch mit ihr leben ;-)
Auf Ihre Kommentare (weiter unten unter dem Text) freue ich mich. Und wenn Ihnen der Beitrag gefällt, helfen Sie mir, dass er seinen Weg in die Welt findet. Also teilen erlaubt :-)
>> Zur Übersicht aller Blog-Beiträge
Weitere Videos finden Sie auf meinem YouTube-Kanal.
Wofür es sich heute noch zu träumen lohnt
Wir zeigen jeden Tag, wie glücklich, erfolgreich und souverän wir sind. Doch hinter der Fassade lauert unsere Angst, über die niemand offen spricht. Wir drohen zum Spielball des unkontrollierten Fortschritts zu werden. Doch wofür lohnt es sich eigentlich heute noch, zu träumen?
Wir zeigen jeden Tag, wie glücklich, erfolgreich und souverän wir sind. Doch hinter dieser Fassade lauert unsere Angst, über die niemand offen spricht.
In meinen Coachings begegnen mir Menschen, die „es“ geschafft haben. Eigentlich. Es sind Unternehmer und Top-Führungskräfte. Sie verdienen sehr gut. Haben ein schickes Haus. Eine tolle Familie. Müssen beim Einkaufen nicht auf jeden Euro achten. Machen unvergessliche Urlaube. Sie leisten sich die neuesten technischen Gimmicks. Tragen teure Uhren. Fahre beeindruckende Autos. Und zu Ihrer Geburtstagsparty kommen 30-40, manchmal auch 100 Gäste. Sie stehen in der Mitte und Blüte ihres Lebens. Und sind dennoch unzufrieden.
Doch darüber sprechen sie normalerweise nicht. Denn diese Unzufriedenheit fühlt sich komisch an. Manche beschreiben sie als „gehetzt, getrieben, rastlos“. Andere als „besorgt und verunsichert“. Manche sogar als „verletzt, traurig, niedergeschlagen“. Aber solche dunklen Abgründe passen nicht in unsere moderne Gesellschaft. Hier zählt es, gut drauf zu sein. Zuversichtlich, optimistisch, dynamisch und motivierend. Stark und souverän. Bloß kein Weichei, Spielverderber oder Skeptiker sein.
Wenn wir den Statistikern glauben, ist die Welt im Laufe der Zeit viel besser geworden. Aber diese gute Botschaft ist in uns noch nicht angekommen. Tiefenpsychologische Couchgespräche von Meinungsforschern zeigen immer wieder – in den Deutschen brodelt Wut. Eine Wut, die durch Selbstkontrolle noch im Zaum gehalten wird – und bisher nur stellenweise ausbricht. Solche Eruptionen zeigen sich dann in Form von Krawall in Chemnitz oder den steigenden Wählerstimmen für die AfD.
Doch warum fühlen wir uns so? Ich sehe vor allem zwei Gründe, weswegen wir die glorreiche Moderne nur mit Angst und Wut genießen.
Legebatterien für Funktionsmenschen
Zum einen haben wir uns eine Kunstwelt geschaffen, für die wir nicht geeignet sind. Moderne Büro-Skylines sind zwar beeindruckend. Doch gleichzeitig erinnern sie mich an Legebatterien für Funktionsmenschen. Jeden Tag marschieren sie – schick verkleidet – in die Büros. Und dann geht der moderne Büro-Krieg los.
Die wesentliche Spielregel lautet: Wir gehen respektlos miteinander um. Aus Sorge, im rasenden Innovations-Wettrennen den Anschluss zu verlieren, wird mit Macht, Druck und Dominanz geführt. Alle sollen mutig sein und neue Dinge ausprobieren, aber keiner darf einen Fehler machen, denn sonst wird der Schuldige sanktioniert. In der Folge wird statt Klartext weichgespült und die Fahne in den Wind gehangen. Bloß nicht die Karriereleiter nach oben pinkeln. Und so herrscht in vielen Unternehmen ein Klima der Angst.
Intrigen und versteckte Spielchen machen den sowieso schon zermürbenden Arbeitsalltag auch noch kompliziert. Wir laufen nicht nur im Hamsterrad, sondern wir legen auch noch verletzende Hindernisse hinein und drehen gleichzeitig die Geschwindigkeit immer höher. Agile Methoden greifen um sich. Alles muss am besten gestern schon fertig sein. Wir leiden unter dem Instant-Virus.
Die Sehnsucht nach Ruhe
Doch bei all dem Lärm und der Geschwindigkeit sehnen wir uns nach Ruhe. Deswegen fahren wir als Ausgleich zum Bürowahnsinn am Wochenende „in“ die Natur. Da frage ich mich: wo waren wir denn während der Woche? Außerhalb der Natur? Wir haben uns von der Natur getrennt. Nicht nur im Sprachgebrauch. Sondern auch in unserem täglichen Verhalten.
Und wenn wir mal „in“ der Natur sind, bewegen wir uns auf Kunstschneisen, die wir in den Wald geschlagen haben. Diese nennen wir Wege. Denn zu viel Natur darf es dann doch nicht sein. Wenn es kreucht und fleucht, sticht und piekst oder einfach nur zu dreckig wird...
Doch wir merken bei all der sauberen Technik in unserer klinischen Kunstwelt: ohne Natur geht es nicht. Das spüren wir innerlich. Und holen uns dann wenigstens in bisschen davon nach Hause. Wir nennen das dann einen Garten. Doch der gefällt uns nur, wenn auch er klinisch sauber ist: die Hecke in Form, der Rasen akkurat – alles für ein optisch stimmiges Erscheinungsbild. Doch auch hier gibt es bereits tumorartige Auswüchse, wenn die Menschen ihren Garten statt mit Bäumen und Blumen nur mit Steinen “bepflanzen”.
Und so verlieren wir im technischen Fortschritt langsam immer mehr den Bezug zu uns selbst.
Fehlender Horizont
Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, dann war es schon super modern, wenn ich mich morgens per Modem in eine Mailbox einwählte, um die Ergebnisse der NBA Playoffs runterzuladen. Das Ganze dauerte rund fünf Minuten. Für eine Tabelle mit Zahlen. Heute schauen wir bei 160km/h auf der Autobahn Videos im Smartphone an – und regen uns auf, wenn die Übertragung ruckelt.
Uns ist gar nicht bewusst, wie viel Rechenpower wir mit diesem kleinen Gerät in den Händen halten. Nämlich mehr, als damals ein Großrechenzentrum in Form eines ganzes Bürokomplexes zu bieten hatte. Mein Smartphone hat 128 GB Speicherkapazität. In den Rechenzentren standen damals waschmaschinen-große Kisten mit einer Kapazität von 500 MB. Heißt: mit meinem Smartphone habe ich 256 Waschmaschinen in der Hosentasche. Und dieser technologische Fortschritt passierte gerade mal in knapp 20 Jahren.
Digitalisierung, Internet der Dinge, Robotik, künstliche Intelligenz, Blockchain, Gentechnik – es gibt so viele unglaublich beeindruckende Durchbrüche in der Forschung. Mit einem atemraubenden Tempo werden wir von Innovationen überrannt.
Doch wozu eigentlich?
Warum brauchen wir all diesen Fortschritt? Ich habe nicht den Eindruck, dass wir hier als Menschheit einen Plan verfolgen. Im Gegenteil: es wird gemacht, was machbar ist. Und wenn es nicht machbar ist, forschen wir solange, bis wir doch einen Weg gefunden haben.
Wir benutzen die Technik nicht, um unser Leben zu verbessern. Es ist genau anders herum: der Fortschritt benutzt uns, um stattzufinden. Wir sind Werkzeuge der Evolution. Und wir stellen selber das Tempo immer höher, ohne zu wissen, in welche Richtung wir eigentlich laufen.
Mittlerweile können wir menschliche Stimmen digital nachbilden. Wir können Videos in Echtzeit manipulieren. Die humanoiden Roboter sehen seit Sophia immer mehr wie wir Menschen aus. Es naht der Tag, da wissen wir nicht mehr, ob wir mit einem Mensch oder einer Maschine kommunizieren. Wir werden nicht mehr wissen, was echt oder eine Fälschung ist. Fake News sind da nur der lächerliche Anfang.
Der technische Fortschritt wird uns mit ungewohnten Fragen konfrontieren:
Werden wir uns in Maschinen verlieben?
Welche Auswirkungen hat das auf unsere Seele?
Haben intelligente Maschinen und Roboter die gleichen Rechte wie wir?
Wer wird bevorzugt in einer Firma befördert: künstliche Intelligenz oder der Mensch?
Wie gehen wir mit Menschen um, die auf Grund des rasenden (!) Fortschritts keine Zeit haben, sich an den modernen Arbeitsmarkt anzupassen?
Dürfen Algorithmen über Personalfragen entscheiden – wer eingestellt, befördert oder entlassen wird?
Darf eine Maschine über unser Schicksal bestimmen – wenn Roboter als Polizisten arbeiten und von ihrer Schusswaffe Gebrauch machen? Oder wenn ein autonom fahrendes Auto in einen unvermeidlichen Crash gerät und sich nun aktiv dafür entscheidet, entweder das Leben der Insassen oder das der Fußgänger aufs Spiel zu setzen?
Uns fehlt als Gesellschaft der Horizont. Stattdessen diskutieren wir über den Diesel-Skandal, Brexit oder die Karriere des umstrittenen (Ex-) Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Wir brauchen keine Kosmetik auf dem Status-Quo. Wir brauchen dringend ein Bild der Zukunft. Das uns zeigt, wo wir hin wollen. Das uns Orientierung gibt. Das Investitionen bündelt. Das uns als Gesellschaft vereint. Das uns klare Leitplanken gibt, was wir wollen – und vor allem auch was wir nicht (!) wollen.
Beispiel: Sie erwarten Nachwuchs. Der Arzt sagt Ihnen, dass das Baby im Bauch einen Gendefekt hat und krank zur Welt kommen wird. Sie können dies durch Genmanipulation verhindern und ein gesundes Kind auf die Welt bringen. Finden Sie Genmanipulation jetzt richtig?
Es beginnt meist damit, dass wir etwas erfinden, um einen Missstand zu heilen. Oder eine Situation zu verbessern. Doch dann werden wir gierig. Wenn wir heilen können, können wir auch designen. Was wäre, wenn Sie durch gezielte Genmanipulation Ihrem Kind ein paar Verbesserungen „einpflanzen“: Mathe-Genie, Sprachtalent, attraktive Körpergröße, durchsetzungsstarkes Wesen, kräftige Muskulatur, ...
Um zu wissen, was geht – und was nicht gehen darf ! – brauchen wir ein Zukunftsbild:
In was für einer Welt wollen wir eigentlich leben?
Da es dieses Bild nicht gibt, rennen wir mit einem beeindruckenden Tempo orientierungslos durch die Gegend. Jeder macht das, was er machen will.
Ein unbegrenzter Liberalismus predigt uns: alles ist möglich. Just do it! Doch Liberalismus braucht Grenzen!
Fressen oder gefressen werden
Schauen wir nochmal in die Natur. Der Stärkere frisst den Schwächeren. Oder der Schlauere besiegt den Dümmeren. Gut ist, wenn Sie oben in der Nahrungskette stehen. Denn es gilt: fressen oder gefressen werden.
Aber wollen wir so leben? Wer beim technischen Fortschritt nicht mithält, fliegt einfach raus? Was machen Sie als Taxifahrer, wenn Sie morgen keinen Job mehr haben, weil das Taxi selbständig fährt? Sie arbeiten einfach als Big-Data-Spezialist – auch wenn Sie keine Ahnung von Computern haben?
Als ich in Karlsruhe mit dem Taxi zu einer Konferenz fuhr, brachte es der Fahrer auf den Punkt: „Ich suche mir einen anderen Job. Und wenn es nicht mehr legal funktioniert, muss ich mir eben andere Wege suchen, um meine Familie zu ernähren.“
Als moderne Zivilisation muss das doch besser funktionieren. Wir haben in Deutschland die soziale Marktwirtschaft. Marktwirtschaft allein bedeutet: fressen oder gefressen werden. Der Zusatz „sozial“ erweckt den Eindruck, dass wir uns dadurch vom Tier unterscheiden. Sozial bedeutet, dass wir eine Zivilisation gebaut haben, die durch Werte und Leitplanken dafür sorgt, dass Fortschritt stattfindet, ohne die Würde des Menschen zu verletzen. Dass Fortschritt nicht um jeden Preis stattfindet, sondern zum Wohle unserer Gemeinschaft. Wobei ich den Eindruck habe, dass die Tiere das Soziale schon von Natur aus einfach können – und vor allem auch besser machen als wir.
Die Angst in uns
Vor uns liegt irgendetwas, das wir nicht sehen können. Und das ist die Ursache für diese diffuse Angst in uns Menschen. Obwohl es gut läuft, spüren Sie dieses komische Gefühl in sich: irgendetwas stimmt nicht... Es ist die Ungewissheit. Dieser Nebel, der vor uns liegt. Wir wissen einfach nicht, was auf dem Weg in die Zukunft auf uns lauert. Und so kann Ungewissheit zu Unsicherheit führen. Doch auf jeden Fall schürt Ungewissheit die Angst.
Wenn ich an die Zukunft denke, dann sehe ich viele Chancen und unglaubliche Möglichkeiten, sich als Mensch zu entfalten. Die Technik wird uns ungeahnte Freiheiten und Potenziale schenken. Ein schönes Bild. Nur der Weg durch diesen Nebel der Ungewissheit, der weckt ins uns dieses komische Gefühl.
Und deswegen reden wir darüber nicht so gerne. Wir lenken uns lieber im Hier und Jetzt ab. Betäuben uns durch viel Arbeit, neue Projekte, hohe Geschwindigkeit, tolle Hobbies, Unternehmungen mit Freunden, Serien-Marathons auf Netflix oder die obligatorische Flasche Wein am Abend.
Doch Ablenken, Betäuben oder Kopf in den Sand stecken sind nicht die Lösung. Populisten oder Möchtegern-Gurus hinterherzurennen, die wie Brüllaffen ihre einfachen Lösungsparolen für komplexe Fragestellungen in die Welt posaunen, ebenfalls nicht.
Zukunft ist nicht vorhersehbar. Wir müssen sie gestalten.
Dieser Schwelbrand in uns hat auch sein Gutes: denn Unzufriedenheit ist der Motor für Veränderungen.
Und es ändert sich eine ganze Menge. Besonders zuversichtlich stimmt mich das, was ich aus den Gesprächen mit Jugendlichen mitnehme. Sie wollen oft keine „blinde“ Karriere um jeden Preis machen. In ihnen ist die Frage nach dem Sinn schon fest verankert. Sie wollen Karriere machen, indem sie etwas Sinnvolles für diese Erde, unsere Gesellschaft und andere Menschen tun.
Und dieser neue Mindset trifft auf eine Zeit, in der es endlich gesellschaftsfähig wird, sich selbständig zu machen. Unternehmen zu gründen und nicht stupide in die bestehenden Karrierepfade einzutreten. Diese neue Generation wird die Art, wie wir Wirtschaft und Zukunft gestalten, mit ihrer neuen Denkrichtung in eine sinnvolle Richtung lenken.
Doch dazu braucht es in unserer Gesellschaft wieder mehr Mut. Mut, den Mund aufzumachen. Eine Meinung zu haben, die auch unbequem sein darf. Wir brauchen wieder mehr besonnene Diskussionen, die hart in der Sache, und fair zum Menschen sind. In der wir den Menschen wieder richtig zuhören – nicht nur, was ihr Kopf sagt, sondern auch was aus ihrem Bauch kommt.
Denn nur wenn wir aufnehmen, was Menschen bewegt, können wir sie auch in eine sinnvolle Richtung führen. Das gilt in Unternehmen – wie auch in unserer Gesellschaft. Und dann haben wir auch eine Chance, dass wir den guten Inhalten wieder mehr Aufmerksamkeit schenken – und nicht den populistischen Brüllaffen.
Dazu brauchen wir keine Revolution von oben. Wir brauchen keine Merkel, keinen Papst oder andere Leitfiguren, die uns sagen, wo es lang geht. Zum Glück: denn es fehlen uns aktuell die starken Führungspersönlichkeiten, die Zukunft im Sinne von einer sozialen Marktwirtschaft gestalten wollen.
Das Gute ist: der notwendige Wandel kann auch “von unten” passieren. Indem jeder Einzelne sich an die eigene Nase packt, auf seine innere Stimme hört und dann als Vorbild vorangeht. Die Summe der Einzelmenschen und ihre Entscheidungen ergeben das Große unserer Gesellschaft. Wir entscheiden, durch das was wir jeden Tag tun – oder nicht tun, wie unsere Zukunft aussieht. Und die stärkste Kraft der Masse ist in einer Marktwirtschaft nunmal der Konsum.
In was für einer Welt willst Du leben? Und was tust Du heute konkret dafür?
Auf Ihre Kommentare (weiter unten unter dem Text) freue ich mich. Und wenn Ihnen der Beitrag gefällt, helfen Sie mir, dass er seinen Weg in die Welt findet. Also teilen erlaubt :-)
>> Zur Übersicht aller Blog-Beiträge
Das einzige Zuhause, aus dem Sie nie umziehen werden
Mal angenommen: Ihnen gefällt Ihr Körper nicht mehr. Oder: Ihr Körper ist krank. Oder: Sie verlieren ein Körperteil. Dann können Sie zwar Ärzte, Schönheitschirurgen oder sonstige Vorzüge des 21. Jahrhunderts nutzen. Doch eines werden Sie nie können: aus Ihrem Körper umziehen. Diese Banalität werden Sie bereits kennen. Doch die Frage ist: Verhalten Sie sich auch entsprechend?
Mal angenommen: Ihnen gefällt Ihr Körper nicht mehr. Oder: Ihr Körper ist krank. Oder: Sie verlieren ein Körperteil. Dann können Sie zwar Ärzte, Schönheitschirurgen oder sonstige Vorzüge des 21. Jahrhunderts nutzen. Doch eines werden Sie nie können: aus Ihrem Körper umziehen.
Diese Banalität werden Sie bereits kennen. Doch die Frage ist: Verhalten Sie sich auch entsprechend?
Das Herz muss verstehen
Es gibt einen Unterschied zwischen kognitiv verstanden und emotional begriffen. Ich wusste zum Beispiel mit Mitte 20 auch, dass Lebenszeit endlich ist. Aber ich habe mich nicht dementsprechend verhalten. Stattdessen habe ich meine Lebenszeit verschwendet. Zu viel Alkohol. Schlechte Ernährung. Zu wenig Schlaf. Viel zu viel Stress. Außerdem verbrachte ich auch noch zu viel Zeit mit den falschen Leute und dem falschen Job. Und das alles, obwohl ich wusste, dass meine Lebenszeit endlich ist.
Wirklich begriffen habe ich das erst, als es emotional wurde. Damals ging es die Karriereleiter steil nach oben. Ich war unglaublich beschäftigt und gierte von Erfolg zu Erfolg.
Als mich die Diagnose Krebs abrupt aus diesem Film heraus riss.
Plötzlich begriff ich auch emotional, was mir kognitiv schon lange bewusst war: das Leben ist lebensgefährlich und endet garantiert tödlich. Den Körper, den ich habe, werde ich nur einmal verlassen - und zwar dann, wenn mein Leben vorbei ist. Er ist das einzige Zuhause, aus dem ich nicht umziehen kann.
Dringend tötet das Wichtige
In meinen Coachings mit Unternehmern begegnen mir immer wieder Menschen, die ebenfalls wissen, dass ihr Körper nicht austauschbar ist. Trotzdem missbrauchen sie ihre Gesundheit. Zwar nicht immer täglich, aber regelmäßig.
Der Sporttermin fällt aus, da noch ein Abendessen mit dem Kunden ansteht. Statt einem kurzen Powernapping (traditionell „Mittagsschlaf“ genannt) werden eMails beantwortet. Mittagspause ist sowieso etwas für Weicheier. Weil aktuell so viele Projekte gleichzeitig laufen, beginnt der Arbeitstag um 07.00 Uhr und endet um 21.00 Uhr. Alles andere wäre ja auch nur ein Halbtagsjob. Das Abendessen der Familie hat währenddessen ohne sie stattgefunden.
Es sind die dringenden Dinge, die unser Leben bestimmen. Und wir opfern dem Dringenden die wichtigen Dinge. Wichtig sind Dinge wie: regelmäßig Sport machen, um dem Stress ein Ventil zu bieten. Zeit mit der Familie verbringen; vor allem die Rituale mit den Lieben einhalten. Gesunde Ernährung. Ausreichend Schlaf. Dem Geist und der Seele eine Auszeit gönnen. All das muss weichen, wenn dringende Themen unsere Aufmerksamkeit brauchen.
Rückenschmerzen brauchen keine Therapie
Nach meiner Krebs-Diagnose hatte ich für mich entschieden, dass mir vorsorgen lieber ist, als nachsorgen. Denn viele körperliche Zipperlein lassen sich vermeiden, wenn man sich rechtzeitig und regelmäßig um seinen Körper kümmert.
Und trotzdem passierte es, dass ich nach einigen Jahren dem Dringlichkeits-Wahn erlag. Es war eine schwierige unternehmerische Zeit. Ich war viel auf Reisen. Und so verließ der Sport mein Leben — und unregelmäßiges und ungesundes Essen erhielt Einzug. Eines Tages spürte ich dann die ersten Zipperlein im Rücken. Ich suchte einen Orthopäden auf. Mein Rücken wurde gescannt. Ich besorgte mir technisch ausgefeilte Einlagen für meine Schuhe. Machte Physiotherapie. Ging zum Rolfing. Ließ mich massieren. Und bekam die Zipperlein in den Griff.
Irgendwann stand ich morgens nackt vor dem Spiegel und war - sagen wir mal - „nicht angetan“ von dem, was ich da zu sehen bekam. Also beschloss ich, endlich wieder meinen gesunden Lebensstil zu reaktivieren. Ich fing mit Krafttraining an. Das mache ich Zuhause („Bodyweight-Training“) - und sogar meistens mit meiner Frau zusammen. Ein Fitness-Studio kostet mir zu viel Zeit (Anfahrt, Parkplatzsuche, Warten an den Geräten) und die Belohnung, mit verschwitzten Männern zu duschen, übt keinen Reiz auf mich aus. Außerdem kann ich das Bodyweight-Training immer und überall absolvieren: von Hotelzimmer bis Urlaub. Nach 3-4 Wochen folgten die ersten Laufeinheiten. Eine lockere 5km-Runde ist immer drin.
Und siehe da: meine Rückenbeschwerden waren verschwunden. Ich brauchte dazu keine Therapie. Einlagen, Masssagen und Co. habe ich wieder aus meinem Leben verbannt. Stattdessen bewege ich einfach nur meinen Körper. Mache also das, wozu er erschaffen wurde.
Die Angst vorm Altern
Der Mensch hat Angst vorm Tod. Deswegen gibt es viele Forscher, die sich mit der Unsterblichkeit beschäftigen. Manche fummeln an unseren Genen herum. Andere wollen unsere Seele digitalisieren. Einige basteln an humanoiden Robotern. In einigen Bereichen gibt es für mich erschreckend großen Fortschritt. Ob wir mit dieser Forschung wirklich Erfolg haben werden, wird sich zeigen.
Für mich ist Unsterblichkeit zumindest kein erstrebenswertes Ziel. Mir ist etwas anderes viel Wichtiger: ich will mein ganzes Leben vital und gesund erleben!
Mein Arzt brachte den Weg zu diesem vitalen Leben auf den Punkt: Die Vitalität ist in jungen Jahren am höchsten. Sie nimmt im Verlauf unseres Lebens mit zunehmendem Alter ab. Dabei durchlaufen wir seiner Ansicht nach drei Phasen.
- Phase 1: bis ca. 40 Jahre. Hier ist es egal, wie Sie mit Ihrem Körper umgehen. Junk Food. Schlafmangel. Wilde Partys. Alkohol. Ihr Körper steckt das alles weg.
- Phase 2: ca. 40 - 60 Jahre. Hier wendet sich das Blatt. Es ist spätestens jetzt wichtig, auf Ihr Gesundheitskonto einzuzahlen. Einen genussvollen Lebens- und Gesundheitsstil zu pflegen. Denn Sie brauchen einen positiven „Kontostand“ für die letzte Phase...
- Phase 3: ab ca. 60 Jahre. Jetzt hängt es davon ab, wie viel Sie bisher auf Ihr Gesundheitskonto eingezahlt haben. Mein Arzt versprach mir nicht, dass ich durch einen gesunden Lebensstil in Phase 2 mein Leben in Phase 3 verlängern kann. Aber er versprach mir, dass ich meinen Lebensabend mit mehr Vitalität gestalten kann.
Und Vitalität ist für mich ein erstrebenswertes Ziel. Lieber Golfplatz als Rollator. Deswegen habe ich mich für „Better safe than sorry“ entschieden — und kümmere mich präventiv um meine Vitalität anstatt zu warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Moderater Köper-Kult
Für mich zeichnet sich ein reifer Erwachsener dadurch aus, dass er Verantwortung für sich und sein Leben übernimmt. Natürlich gehört es dazu, in einigen Lebensbereichen auch mal riskante Entscheidungen zu treffen. Doch sollte die eigene Gesundheit kein Spieleinsatz im Casino des Lebens sein. Im Gegenteil: bei meiner Gesundheit gehe ich lieber auf Nummer sicher. Ich habe mir die Frage gestellt: Wozu will ich eigentlich Zeit, Energie und Geld in meine Gesundheit investieren? Eine Sportlerkarriere will ich nicht mehr hinlegen. Und aufs Titelblatt der Men‘s Health will ich auch nicht. Nach einigem Nachdenken fand ich die Antwort:
Ich will von meinem Körper die maximale Energie abrufen können, um mein Leben in allen Bereichen aktiv zu gestalten.
Und diese Vitalität hat nunmal - wie alles im Leben - ihren Preis. Heißt: bewusst ernähren und Sport machen. Und wer jetzt wieder mit der Ausrede kommt, dass er keine Zeit für seine Gesundheit hat, lügt sich schlichtweg selber an. Denn Zeitmangel ist keine Ressourcen-, sondern eine Prioritätenfrage.
In Breslau habe ich kürzlich einen Verwandten besucht. Er ist verheiratet. Zweifacher Vater. Die Tochter ist 2,5 Jahre, der frisch geborene Sohn gerade mal 2,5 Monate. Er ist Alleinverdiener. Hilft dennoch viel Zuhause und unterstützt seine Frau. Wenn die Tochter nachts schreit, steht er auf. Obwohl in ein paar Stunden ein fordernder Job auf ihn wartet.
Und trotzdem: Jeden Morgen zieht er seine Laufsachen an. In den Rucksack packt er die Klamotten fürs Büro. Und dann joggt er los. Die Strecke zwischen Wohnung und Firma beträgt 10km. Im Büro duscht er. Zieht sich um. Arbeitet. Und fährt abends mit der Bahn zurück. 10km Joggen. Jeden Tag. Keine Ausnahmen.
Gesundheit ist eben keine Frage von punktuellen Trainings. Oder 2-wöchigen Kur-Aufenthalten. Oder dem neuesten Trainings-Equipment. Gesundheit ist eine Frage Ihres persönlichen Lebensstils.
Dabei muss es ja nicht in einen extremem Körper- und Gesundheitskult ausarten. Es reicht völlig, mit gesundem Menschenverstand auf sich und seinen Körper zu achten. Ich fasse diese Verantwortung für mich in einem Wort zusammen. Es klingt zwar nicht sexy, ist aber hilfreich: Selbstfürsorge.
Wie sorgsam gehen Sie mit Ihrem Körper um — damit Sie darin noch lange und vital leben und maximale Energie abrufen können?
Auf Ihre Kommentare (weiter unten unter dem Text) freue ich mich. Und wenn Ihnen der Beitrag gefällt: teilen erlaubt :-)
>> Zur Übersicht aller Blog-Beiträge
Wer Sicherheit will, muss Risiken eingehen
Die meisten geben es nicht zu: aber viele Menschen lassen sich durch ihre Angst leiten. Ob beruflich oder privat: Angst beeinflusst Ihre Gedanken und Ihre Handlungen – und damit auch, wie Sie sich fühlen. Ein riskanter Weg, der in einer Sackgasse endet.
Die meisten geben es nicht zu: aber viele Menschen lassen sich durch ihre Angst leiten. Ob beruflich oder privat: Angst beeinflusst Ihre Gedanken und Ihre Handlungen – und damit auch, wie Sie sich fühlen. Ein riskanter Weg, der in einer Sackgasse endet.
Ich habe es selbst oft genug erlebt – und beobachte es in meinen Coachings regelmäßig: wer Sicherheit will, muss Risiken eingehen. Das gilt in allen Lebensbereichen. Ich erzähle Ihnen drei Geschichten und bin gespannt, wie Ihre Haltung zu meiner These ist.
Eheglück
Als ich damals das Herz meiner heutigen Frau erobert habe, war die leichte Aufgabe erfüllt. Die eigentliche Herausforderung begann danach: ein Leben lang glücklich verliebt zu bleiben. Und hier stellte ich mich – sagen wir mal positiv formuliert – ungeschickt an.
Als Mann gibt man das nicht gerne zu. Aber tief in meinem Herzen sehnte ich mich nach Sicherheit. Wer will schon gerne emotional verletzt werden. Das Problem war, dass ich mich damals mit solchen Themen nicht wirklich beschäftigt habe. Selbstreflektion war ein Fremdwort. Das einzige, was zählte, waren Business, Erfolg und der abgedroschene Spruch „Zahlen, Daten, Fakten“. Eine Haltung, die ich teuer bezahlen musste...
Denn unbewusst übernahm meine Sehnsucht nach emotionaler Sicherheit die Kontrolle über mein Verhalten. Sie suchte sich den einfachsten Weg zur Sicherheit, indem sie eine Schutzmauer um mein Herz baute. Heißt konkret: ich ließ mich nicht 100%-ig auf die Beziehung zu meiner Frau ein. Zeigte wenn, dann nur andeutungsweise Gefühle. Und fuhr sozusagen mit emotionaler Handbremse.
Das ist für mich aus heutiger Sicht nachvollziehbar. Wenn das Herz nicht verletzt werden will, schützt es sich eben.
Ähnliches erlebe ich bei jedem dritten Unternehmer, den ich coache, und auch im privaten Freundeskreis. Ein Freund traf sich mit einer neuen Internet-Bekanntschaft. Es lief aber nicht so wirklich rund. Ich fragte ihn, was sie sich denn per SMS schreiben. Er zeigte mir den Chat-Verlauf.
Ich stutzte und fragte ihn: „Warum schreibst Du ihr nicht, dass Du sie vermisst?“
Seine prompte Antwort: „Auf keinen Fall.“
Ich: „Warum denn nicht?“
Er: „Das ist zu offen. Wenn sie dann nicht antwortet, stehe ich blöd da.“
Aus den beiden ist natürlich nichts geworden. Seine Erwartungshaltung „Die Frau ist sowieso die Falsche“ wurde sozusagen bestätigt. Da es mit den beiden noch gar nicht richtig losgegangen war, war der Preis ein kleiner.
Bei mir war die Folge meines Sicherheits-Strebens gravierender, denn ich habe dadurch fast meine Ehe verloren. Es nutzt einfach nichts, wenn man seine Gefühle und Emotionen hinter einem Staudamm zurückhält. Denn dann weiß der Partner nicht, wo er dran ist. Das Verhalten wirkt vielleicht zögerlich. Oder unsicher. Und sorgt auf jeden Fall für Irritationen, Angst und Konflikte. Der Weg zu wahrer Liebe geht in die andere Richtung: mit Offenheit, Verletzlichkeit und Unsicherheit.
Den Krebs besiegt
Mit Mitte 20 wurde bei mir Schilddrüsen-Krebs diagnostiziert. Damals war ich auf einem beruflichen Höhenflug in der Finanzbranche unterwegs. Die Diagnose Krebs zerstörte mein verblendetes Gefühl der Unsterblichkeit.
Damals war ich ein Kontroll-Mensch – und bin es heute immer noch. Zumindest ist es mir lieber, einen Plan zu haben und Stellschrauben zu kennen, mit denen ich eine Situation oder ein Ergebnis beeinflussen kann. Doch heute gehe ich gelassener damit um, dass eben nicht alles kontrollierbar ist. Denn ich erhielt eine heftige Lektion. Und zwar auf dem OP-Tisch.
Die Behandlung meines Tumors bearbeitete ich strukturiert wie ein Projekt. So akribisch, genau und engagiert hatte ich bis dato noch nicht gearbeitet. Ich ging davon aus, dass ich durch diese Kontrolle Sicherheit bekomme.
Dann kam der Tag der OP. Auf die Beruhigungstablette hatte ich verzichtet, so dass ich noch klar bei Verstand war. Das Risiko der Operation war, dass ich meine Stimme verlieren könnte. Also murmelte ich zum Anästhesisten: „Passen Sie auf meine Stimme auf!“ Doch er antwortete nur ruhig: „Herr Holzer, jetzt ist es Zeit, uns zu vertrauen.“ und leitete das Betäubungsmittel ein...
Ich musste mich in diesem Moment einfach führen lassen und die Kontrolle abgeben. Mich also „verletzlich“ geben und die Unsicherheit gehen.
Erst säen, dann ernten
Ich begleitete mal eine Unternehmerin dabei, ihr Unternehmen auf die nächste Ebene zu entwickeln. Ihre Firma war in einer kritischen Phase: zu klein, um einen Durchbruch zu erzielen. Und zu wenig Mittel, um die notwendigen Investitionen zu tätigen. Was also tun?
Die Arbeit potenzierte sich – und zwar auf ihrem Schreibtisch. In der Gründungsphase war sie der Treiber. Ihre Haltung „Der Laden läuft wegen mir“ hat dafür gesorgt, dass es nach wenigen Jahren bereits richtig gut lief. Aber eben noch nicht gut genug. Und ihre Haltung legte sich nun wie eine Schlinge um den Hals. Vom Treiber des Wachstums ist sie zur Bremse geworden. Es war zu viel. Sie kam nicht mehr hinterher.
Die Lösung: neue Mitarbeiter einstellen. Doch dazu fehlte das Geld. Wir diskutierten diese Situation intensiv. Am Ende war ihr klar: sie hatte Angst. Angst davor, zu investieren, ein Risiko einzugehen, das sich am Ende nicht bezahlt machen würde.
Sie sehnte sich nach einem Gefühl von Sicherheit. Damit verband sie ein erfolgreiches Unternehmen, in dem sie nicht der Flaschenhals ist, sondern gute Mitarbeiter die Arbeit machen. Und sie erkannte, dass sie für diese Sicherheit zunächst einmal in die Unsicherheit muss. Ohne das Risiko, Geld in neue Mitarbeiter zu investieren, würde sie diese Sicherheit nie erreichen.
Und so hat sie ein Darlehen aufgenommen. Drei neue, gute und damit auch teure Mitarbeiter eingestellt. Und schaut heute mit einem stolzen Schmunzeln auf diese „gute alte“ und lehrreiche Zeit zurück.
Der Widerspruch der Sicherheit
Wer also Sicherheit will, muss in die Unsicherheit gehen. Es ist wie ein Paradox, also ein Widerspruch in sich. Doch nur, wenn Sie etwas im Leben wagen, wird sich auf Dauer Ihre Situation verbessern.
Dazu braucht es hin und wieder auch Mut. Mut den Mund aufzumachen und ins Tun zu kommen. Pläne schmieden und träumen reicht nicht. Sie müssen es auch umsetzen. Und vielleicht hilft Ihnen dabei noch ein Gedanke: oft ist es gar nicht der Schritt in die Unsicherheit. Sondern es ist nur eine Ungewissheit, die Sie zurückhält. Doch sie brauchen nur loszulaufen – und Sie werden sehen: der Weg wird klar, wenn Sie ihn gehen!
Passend zum Artikel finden Sie hier ein Video aus meiner YouTube Serie #CappuccinoFriday. Jeden Freitag erscheint eine neue Folge, in der ich ein Thema für Sie auf den Punkt bringe. Schauen Sie doch mal rein und abonnieren Sie den Kanal.
Wie nur ein Satz die Marke Bulgari zerstört
Eine luxuriöse Marke aufzubauen, braucht mindestens drei Dinge. Viel Geld. Gutes Marketing. Und ausreichend Zeit. Bulgari brauchte nur eine falsche Mitarbeiterin am richtigen Ort, um den ganzen Aufwand hinfällig werden zu lassen. Daraus können wir als Unternehmen, aber auch als Einzelperson viel lernen.
Wie nur ein Satz die Marke Bulgari zerstört
Eine luxuriöse Marke aufzubauen, braucht mindestens drei Dinge. Viel Geld. Gutes Marketing. Und ausreichend Zeit. Bulgari brauchte nur eine falsche Mitarbeiterin am richtigen Ort, um den ganzen Aufwand hinfällig werden zu lassen. Daraus können wir als Unternehmen, aber auch als Einzelperson viel lernen.
Während meines Studiums verbrachte ich ein Jahr im Ausland und studierte unter anderem in Chicago. Am Ende hing ich noch ein Praktikum in New York dran. Als ich aus einem Kurzurlaub in Mexiko zurückfliegen wollte, musste ich in Los Angeles umsteigen. Man kann es kaum glauben, jedoch war ich auf dieser Reise ohne Mobiltelefon unterwegs. Zum Glück gab es damals noch ausreichend Münztelefone, denn ich wollte meine Freundin anrufen.
Der Haken an der Sache: ich hatte kein Kleingeld dabei. Also betrat ich das nächstbeste Geschäft: eine Boutique der Luxusmarke Bulgari. Der Laden wirkte sehr hochwertig, aber auch etwas steif und steril. Dieser Eindruck wurde noch verstärkt, da ich der einzige Kunde war. Hinterm Tresen saß eine attraktive, junge Frau. Ich fragte sie: „Können Sie mir den hier wechseln?“ und hielt ihr einen 5-Dollar-Schein hin.
Sie blieb sitzen. Musterte mich von oben bis unten: Badeshorts, Sandalen und Rucksack. Das war wohl nicht das, was sie gerne sehen wollte. Ihr Blick war sowas von herablassend und angewidert, dass ihre arrogante Antwort kaum mithalten konnte: „Wir haben hier nicht wirklich Wechselgeld!“
Worte sind Schall und Rauch
Auf der Homepage von Bulgari wird die Personalleiterin, Isabelle Castellini, zitiert: „Die zwei wichtigsten Dinge in einem Unternehmen erscheinen nicht in seiner Bilanz: sein Ansehen und seine Mitarbeiter.“ Eine starke Aussage, die ich teile. Jedoch nutzen diese Worte nichts, wenn ihnen keine Taten folgen. Die Mitarbeiterin in Los Angeles hatte damals anscheinend noch nicht gewusst, wie wichtig das Ansehen ihres Unternehmens in der Öffentlichkeit ist.
Toll formulierte Werte, Handlungsmaximen und Versprechungen sind ein guter Anfang. Aber das reicht nicht. Wer nur verspricht, aber nicht liefert, ist ein Verlierer.
Beispiel Ehe: Wenn der Ehemann verspricht, um 17.30h vor dem Café Reicharts auf seine Frau zu warten, dann sollte er 17.25h dort sein. Wenn stattdessen um 17.34h das Handy seiner Frau klingelt und er erklärt, „Ich steckte noch im Büro fest und bin jetzt auf dem Weg zu Dir“, dann ist das einfach nur unzuverlässig.
Beispiel Büro: Am Freitag steht um 12.00h das Projektmeeting auf dem Plan. Alle Teilnehmer sind vorbereitet und haben ihre Aufgaben erledigt und die Ergebnisse mitgebracht. Zwei erscheinen ohne Ergebnisse. Sie hielten es jedoch nicht für nötig, vor dem Treffen mit den anderen Teilnehmern zu kommunizieren, dass sie die Aufgaben nicht schaffen werden. Sie warteten bis zum Termin, der nun Zeitverschwendung ist, da ohne die Ergebnisse keine Entscheidungen getroffen werden können. Diese beiden Mitarbeiter sind unzuverlässig.
Der Ruf, der Ihnen vorauseilt
Unternehmen besitzen eine Marke. Aber auch Sie als Einzelperson sind eine Marke. In beiden Fällen gibt es starke Parallelen. Denn eine Marke ist nichts anderes, als ein Ruf, der Ihnen bzw. dem Unternehmen vorauseilt. Eine Marke suggeriert Vertrauen in die Qualität der Person oder des Unternehmens.
Mit meiner Frau und meinem Sohn bin ich mit dem Rucksack durch Malaysia gereist. Wir kamen nach Zwischenstopps in Dubai und Singapur endlich in Kuala Lumpur an. Auf der Reise hatten wir uns irgendetwas eingefangen und verbrachten den ersten Tag schlafend im Hotel, immer in der Nähe der Toilette... Abends wagten wir uns das erste Mal raus. Wir hatten Hunger. Die Stadt und die vielen kleinen Kochküchen waren interessant, aber fremd für uns. Das Risiko einer weiteren Magenverstimmung wollten wir nicht eingehen. Der Hunger zog uns tiefer in die Stadt. Und da tauchte es auf: das goldene „M“. Wir schauten uns an und unsere Blicke brauchten keine weiteren Worte: McDonald’s war genau das richtige für uns.
Das goldene „M“ ist eine Marke. Weltweit steht sie für ein bestimmtes Wert- und damit auch Qualitätsversprechen. Auch wenn ich kein Fan von Junk-Food bin, war mir diese Qualität an jenem Abend wichtiger, als das Risiko einzugehen, in einer unbekannten Garküche zu essen.
Vergessen Sie den ersten Eindruck
Marken sind Symbole für Vertrauen. Es braucht viel Zeit, Engagement und Kontinuität, um die Gravitation einer Marke aufzuladen. Dazu reicht es nicht, einen tollen, ersten Eindruck zu hinterlassen. Das hilft kurzfristig. Aber Sie müssen auch langfristig die Qualität des Ersteindrucks liefern.
Denn der erste Eindruck wird durch den zweiten Eindruck überschrieben. Denken Sie an mein Bulgari-Erlebnis. Erster Eindruck: hochwertige Luxus-Marke. Zweiter Eindruck: arrogante Tussi, die sich für was Besseres hält.
Ähnliches passiert auch im Zwischenmenschlichen. Sie haben sicherlich schon mal eine Situation wie diese erlebt: Sie sind mit einem potenziellen Geschäftspartner zum ersten Mal verabredet, kennen die Person also nicht. Sie betreten den Raum und sehen einen unglaublich intelligent wirkenden Herrn am Tisch sitzen. Der Anzug sitzt perfekt. Das dunkelblau passt farblich perfekt zur dunklen Krawatte. Auf dem Tisch liegen ein hochwertiger Füllfederhalter und ein schönes Ledernotizbuch. Sie denken sich: „Wow, das wird bestimmt ein toller Termin“. Und dann macht die Person den Mund auf. Die Stimme klingt fiepsig. Der Mann spricht in genau dem Dialekt, den Sie überhaupt nicht mögen. Inhaltlich kommt nur seichter Kram heraus. Und dann versucht er es auch noch mit einem Witz, für den Sie sich fremdschämen. Ich weiß, Sie sind nicht so primitiv, dass Sie sich auf Grund solcher „Oberflächlichkeit“ eine Meinung über einen Menschen bilden. Für die meisten anderen gilt jedoch: der zweite Eindruck dieses Herrn überschreibt den ersten Eindruck. So bleibt er Ihnen – trotz beeindruckendem Anzug – negativ in Erinnerung.
In vielen Unternehmen erlebe ich immer wieder, wie auf die großen Themen wert gelegt wird: Leitbilder, Slogans und Kampagnen. Und Sie kennen sicherlich auch die Mitmenschen, die voller Tatendrang mit gewaltigen Worthülsen um sich werfen. Dabei zeichnet sich Qualität eben nicht in diesen großen Brocken aus. Es sind gerade die kleinen Dinge, auf die es ankommt. Es ist wie bei einem Kometen, der auch nicht nur auf Grund seiner schieren Größe glüht. Es sind die Staubkörner, die die leuchtende Magie erzeugen.
Wie sieht es bei Ihnen aus? Wofür wollen Sie als Marke stehen? Und was erzählen die Menschen tatsächlich über Sie, wenn Sie mal nicht im Raum sind? Wie groß ist die Lücke zwischen Schein und Sein?
Mehr dazu in meinem #CappuccinoFriday. Es handelt sich um eine kostenlose Video-Serie. Jeden Freitag erscheint auf YouTube eine neue Folge. Schauen Sie doch mal rein und abonnieren Sie meinen Kanal.
Ergebnisse fallen nicht vom Himmel
Eine professionelle Vertriebsarbeit sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Aber ich erlebe immer wieder Unternehmen, deren Vertriebs-Mitarbeiter ihren Rasen zuhause ambitionierter pflegen als ihren Markt im Beruf. Was die Spreu vom Weizen im Vertrieb trennt, liegt an grundsätzlichen Prinzipien. Und die bleiben trotz der ganzen Veränderungen die gleichen.
Keine Zeit zum Lesen? Dann hören Sie doch einfach rein:
Eine professionelle Vertriebsarbeit sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Aber ich erlebe immer wieder Unternehmen, deren Vertriebs-Mitarbeiter ihren Rasen zuhause ambitionierter pflegen als ihren Markt im Beruf. Und das liegt nicht an neuen Technologien, Digitalisierung oder verändertem Kundenverhalten. Denn Veränderungen und Innovationen gab es schon immer – und wird es auch immer geben. Was die Spreu vom Weizen im Vertrieb trennt, liegt an grundsätzlichen Prinzipien. Und die bleiben trotz der ganzen Veränderungen die gleichen.
Als ich nach meinem Studium den Vertrieb eines Private Equity Fonds übernahm, fühlte ich mich stolz. Schicker Anzug, tolle Hotels, viele Termine. Der Haken an der Sache war nur, dass der Umsatz stagnierte. Und das, obwohl ich unzählige Verkaufsseminare besucht hatte: Kundenergründung, Fragetechniken, Einwandbehandlung, Abschlusstechniken. Doch es änderte sich leider – nichts. Als ich einem väterlichen Freund, der auf eine erfolgreiche Karriere in der Werbebranche zurückblickte, eines Abends mein Leid klagte, fragte er mich: „Was machst Du denn beruflich?“ Meine Antwort: „Ich bin Berater.“ Darauf er: „Das ist der Fehler.“
Eine Frage der Haltung
Ich schaute ihn nur mit fragenden Augen an. Und er erklärte mir: „Du willst den Umsatz Deines Unternehmens steigern. Warum antwortest Du mir dann auf die Frage, was Du beruflich machst, nicht: Ich bin Verkäufer?“
Auf diese Frage wusste ich keine Antwort. Er hatte anscheinend einen wunden Punkt in mir getroffen. Denn ich merkte, wie sich in mir alles zusammenzog. Verkäufer – das ist nicht das, was mich mit Stolz erfüllte. Berater oder Unternehmer klingen da schon besser. Verkäufer waren für mich dubiose Gebrauchtwagenhändler oder Vertreter von Versicherungs-Drückerkolonnen, wo eines klar ist: irgendwie wollen sie dich über den Tisch ziehen. Und so einer wollte ich nicht sein.
An jenem Abend erklärte er mir weiter: „Wenn Du etwas machst, hinter dem Du innerlich nicht stehst, dann wird das nichts. Zwar kannst Du Dich kurzfristig verbiegen. Aber auf Dauer kann das nicht klappen. Wenn Du also den Umsatz steigern willst, helfen Dir keine Verkaufstechniken, wenn Deine Haltung als Verkäufer die falsche ist.“
Damit hat er recht. Ohne Haltung kein Erfolg. Stellen Sie sich vor, Sie leben in einer Beziehung mit einem Menschen. Doch innerlich wissen Sie, dass das nichts fürs Leben sein wird. Wenn Sie also alleine unterwegs sind, genießen Sie die Momente, in denen fremde Menschen Ihnen flirtende Blicke zuwerfen mehr, als wenn Ihnen Ihr Partner in die Augen schaut. Zuhause reißen Sie sich jedes Mal zusammen und machen gute Miene zum bösem Spiel. Doch Sie wissen, auf Dauer wird es Sie zerreißen, wenn Sie sich weiter gegen Ihre innere Haltung verhalten.
Prüfen Sie also, welche Haltung Sie und Ihre Vertriebler zum Verkauf haben. Was antworten Sie auf die Frage: „Was machen Sie beruflich“? Verkäufer? Oder doch eher: Berater, Kundenbetreuer, Key Account Manager, ...?
Veränderungen erfolgreich umsetzen: System schlägt Zufall
Eine klare Haltung ist also die Basis für Ihren Vertriebs-Erfolg. Denn wer klar ist, der hat auch Power. Doch die Haltung allein reicht nicht. Es braucht auch die richtige Handlung. Also was tun Sie konkret, um für Ergebnisse zu sorgen? Diese Frage ist in vielen Lebensbereichen entscheidend. Ob Sie abnehmen, in Ihrer Beziehung neue Leidenschaft entfachen oder im Vertrieb für gute Ergebnisse sorgen wollen.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn wir offen und ehrlich sprechen, dann stelle ich mir regelmäßig die Frage, wie sich mein Unternehmen in den nächsten Jahren entwickeln wird. Angst würde ich das nicht nennen. Eher eine konstruktive Anspannung, die mich wach und agil hält. Denn ich gestalte Veränderungen lieber aktiv als reaktiv – und bevorzuge es, als Gewinner vom Platz zu gehen.
Um als Unternehmen als Gewinner vom Platz zu gehen, brauchen Sie verschiedene Dinge – doch auf jeden Fall einen zuverlässigen und vorhersehbaren Vertriebs-Erfolg. Gute Produkte und Dienstleistungen reichen nicht. Sie müssen sie auch erfolgreich verkaufen. Vertriebs- Erfolg sorgt also für Sicherheit. In meinen früheren Tätigkeiten als Vertriebsverantwortlicher hat sich im Laufe der Jahre ein System entwickelt, das die Chance auf Erfolg drastisch erhöht. Es besteht aus vier Zahnrädern, die ein einfaches, aber wirksames System ergeben.
Zahnrad 1: Ergebnis-Ziel
Zunächst muss das Ergebnis klar sein, das Sie erreichen wollen. Ich erlebe in der Diskussion mit Geschäftsführern immer wieder, dass das Ziel vermeintlich klar ist. Aber eben nur vermeintlich. Der Inhaber eines mittelständischen Familienunternehmens wandte sich beispielsweise an mich, um die Führungsleitlinien zu überarbeiten. Es herrschte Klarheit, was das Ziel des Projekts sein soll. Im Gespräch hinterfragte ich dieses Ziel – und es kam heraus, dass es ihm darum ging, die Unternehmenswerte zu bewahren und in allen Unternehmensbereichen – auch in den ausländischen Gesellschaften – zu leben. Also ein völlig anderes Ergebnis, als einfach nur irgendwelche Leitlinien zu erarbeiten und in Hochglanzbroschüren zu verteilen, die dann sowieso nur im Regal oder Papierkorb landen.
Auch im Vertrieb brauchen Sie Klarheit. Denn jedes Ziel führt zu anderen Umsetzungsmaßnahmen. Also, was ist das konkrete Ergebnis-Ziel, das Sie erreichen wollen?
- Umsatz innerhalb von 12 Monaten von 114 Mio. € auf 136 Mio. € erhöhen.
- Mindestens 100 Neukunden bis zum Ende Q3 gewinnen.
- Den durchschnittlichen Gewinn / Kunde von 36% auf 45% steigern.
- ...
Das Ergebnis-Ziel ist für mich der Output, den Sie generieren wollen.
Zahnrad 2: Aktivitäts-Ziel
Aus Ihrer Lebenserfahrung wissen Sie, dass viele Wege nach Rom führen. So ist es auch mit Ihrem Ergebnis-Ziel. Sie können aus einer Vielzahl von Aktivitäten wählen, um das Ergebnis zu erreichen.
Nehmen wir als Beispiel, dass Sie Ihren Körperfettanteil von 21% auf 18% reduzieren wollen. Welche Aktivitäten könnten Sie dafür in Angriff nehmen? Keinen Zucker mehr essen. Kalorienzufuhr auf max. 2.000 pro Tag begrenzen. Drei Mal die Woche joggen gehen. Magen operativ verkleinern lassen. Zwei Wochen Abnehmkur buchen. Einen Ernährungsberater aufsuchen.
Die Möglichkeiten sind vielfältig. Und wenn Sie sich ausreichend Zeit nehmen, kommen Sie auf immer neue Ideen. In der Praxis zeigt sich, dass die besten Lösungen häufig nicht offensichtlich sind. Denn es gibt immer eine Abkürzung zum Ziel. Diese Abkürzung kann eine Aktivität sein, die günstiger, schneller, einfacher, machbarer ist und uns so schneller ans Ziel bringt. Manchmal müssen wir nur den Umweg des Nachdenkens gehen, um die Überholspur für die Umsetzung zu finden.
Wenn im Vertrieb Ihr Ziel steht (Beispiel: 100 Neukunden gewinnen), welche Aktivitäten können Sie nun verfolgen?
- Alle Bestandskunden nach Empfehlungen fragen
- Kunden-Leads kaufen
- Drei Messen in diesem Jahr als Aussteller besuchen
- Pro Woche mindesten 5 Neukunden anrufen
- ...
Wenn Ihr Ergebnis-Ziel (= Output) steht, suchen Sie nach dem geeignetsten Aktivitäts-Ziel (= Input). Sammeln Sie möglichst viele Ideen, um sich dann für die wirkungsvollsten 2-3 Aktivitäten zu entscheiden. Denn mit der richtigen Aktivität finden Sie garantiert auch eine Abkürzung zum Ergebnis.
Zahnrad 3: Fortschritt visualisieren
Die Definition klarer Ziele ist eine wichtige Voraussetzung für Erfolg. Aktivitäten und Ergebnisse gehören sind jedoch nur Teil des Kapitels „Pläne schmieden“. Und damit sind Sie leider noch keinen spürbaren Schritt vorangekommen. Denn nun gilt es, das entscheidende Kapitel zu beherrschen: die Umsetzung.
In meinen Projekten erlebe ich immer wieder, dass wir Menschen zu viel reden. Der Haken: es kann sich keiner merken, was Sie vor drei Minuten genau gesagt haben. Und so verliert sich die Wirkung unseres Tuns und versumpft dabei im Tagesgeschäft. Schlauer ist, wenn Sie die wirklich wichtigen Themen sichtbar machen, indem Sie sie visualisieren.
Im Vertrieb hat sich dazu ein Scoreboard bewährt. Dieses Board sollte möglichst einfach und schnell zu pflegen sein, sonst verlieren Ihre Mitarbeiter die Lust, es zu benutzen.
Visualisieren Sie auf dem Scoreboard sowohl Ergebnis- (Output) als auch die Aktivitäts-Ziele (Input). Wenn Input und Output sichtbar sind, erkennen die Beteiligten, dass es einen Zusammenhang gibt. Dass der Input die Stellschraube ist, an der ich drehen muss, um den gewünschten Output zu erzielen.
Um im obigen Abnehm-Beispiel zu bleiben: wenn die Aktivität auf Ihrem Scoreboard zeigt, dass Sie täglich mehr als die vereinbarten 2.000 kcal zu sich nehmen, ist es nicht verwunderlich, dass die Ergebnisse (Körperfett) eher schlechter als besser werden.
Wir brauchen also ein ehrliches Feedback zu dem, was wir konkret im Alltag für unser Ziel tun. Nur wenn wir der Wahrheit ins Auge blicken, können wir besser werden. Das gilt auch im Vertrieb, auch wenn diese Wahrheit manchmal schmerzhaft ist. Wenn das Ergebnis-Ziel ist, 100 Neukunden zu gewinnen, und das Aktivitäts-Ziel „täglich 5 potenzielle Neukunden anrufen“ lautet – und die tatsächlichen Zahlen bei „1 Anruf pro Tag“ dümpeln, ist klar, wo das Problem liegt.
Wenn Sie eine Veränderung umsetzen wollen, brauchen Sie ein Scoreboard, das Ihren Fortschritt visualisiert. Das gilt umso mehr, wenn Sie die Verhaltensweisen von Menschen verändern wollen.
Zahnrad 4: Wöchentlicher Follow-Up
Wenn Sie die drei beschriebenen Schritte gegangen sind, fehlt nur noch eine letzte Zutat. Ohne diesen letzten Baustein gehe ich mit Ihnen jede Wette ein, dass Ihr Vorhaben eher scheitert als erfolgreich wird. Denn was jetzt noch fehlt ist: Konsequenz in der Umsetzung.
Ich erlebe in meinen Umsetzungs-Begleitungen immer wieder, dass die Menschen top ausgebildet sind, viel Erfahrung haben, voll motiviert sind und schlaue Pläne schmieden – aber ihr größter Feind sie von der Umsetzung abhält. Und dieser Feind ist: das Tagesgeschäft. Denn es wütet wie ein Tornado durch ihren Kalender. Und Zack – schon wieder ist ein Tag vorbei, an dem wir nicht an der Veränderung gearbeitet haben...
Um sicherzustellen, dass die Veränderung trotz Tagesgeschäft erfolgreich wird, hilft nur, wenn Sie am Ball bleiben. Und das machen Sie am besten durch einen wöchentlichen Follow-Up. Wenn Sie keine denglischen Begriffe mögen, nennen Sie es „Nachfassen“. Worum geht es hier? Ich bin ein großer Fan des „Kaizen“: in kleinen, konsequenten Schritten zum Veränderungserfolg. Und genau darum geht es.
Für mich hat sich als wöchentlicher Follow-Up folgendes bewährt:
- Definieren Sie ein Jour Fix: jede Woche, gleicher Tag, gleiche Uhrzeit, telefonisch oder persönlich
- Halten Sie das Meeting kurz: anfangs max. 30 Minuten, da sich alle Beteiligten an das Format gewöhnen müssen. Ziel ist: max. 10 Minuten. Das klappt im Laufe der Zeit, wenn alle sich gut auf den Termin vorbereiten.
- Der verantwortliche Leiter eröffnet, indem er auf das Scoreboard für die Firma eingeht: wo wollen wir hin? Wo stehen wir aktuell?
- Danach gibt jeder Teilnehmer ein kurzes, ergebnis-orientiertes Update. Dabei hat sich folgender Dreiklang bewährt: (1) Was war mein Ziel für letzte Woche? Wo liegen aktuell Steine im Weg Wo brauche ich Hilfe? Was ist mein Ziel für kommende Woche?
- Entscheidend ist, dass Sie das Meeting fokussiert halten. Kein Small-Talk. Keine Abschweifungen. Sondern Fokus ausschließlich auf Ihr Kernthema.
- Dazu gehört auch, dass Sie Probleme in diesem Meeting nur ansprechen – aber nicht lösen. Definieren Sie nur eine Person, die sich um die Lösung des Problems kümmert. Und zwar nach dem Meeting. Ziel ist, das Meeting kurz und knapp zu halten. Voller Ergebnis-Fokus. Nur so werden Ihre Vertriebskollegen auf Dauer mit Freude zum Meeting erscheinen.
- Wenn eine Person unvorbereitet erscheint oder ihre Wochenaktivität nicht umgesetzt wird, brauchen Sie als Teamleiter meist gar nichts tun. Denn der Musketier-Gedanke „Einer für alle – alle für einen“ wird nun sichtbar, wenn das Team sich von selbst maßregelt.
Beispiel für ein Teilnehmer-Feedback:
- Mein Ziel für letzte Woche war, 4 Bestandskunden anzurufen und nach Empfehlungen zu fragen. Ich habe mit 4 Kunden gesprochen und insgesamt 6 gute Empfehlungen erhalten, mit denen ich teilweise bereits Kennenlerntermine vereinbart habe.
- Steine liegen derzeit keine im Weg.
- Mein Ziel für nächste Woche ist, 2 Bestandskunden nach Empfehlungen zu fragen und 4 Kennenlerntermine wahrzunehmen.
Entscheidend ist, das Ziel für die kommende Woche greifbar und machbar zu halten. Wichtig ist, dass wir von Woche zu Woche unsere Aktivitäts-Ziele erreichen. So entsteht Momentum! Und eine „Wir können es schaffen“-Mentalität verbreitet sich. Erfahrungsgemäß müssen Sie Ihre Mitarbeiter dazu ermahnen, die Wochenziele eher klein zu halten, da es fatal wäre, wenn wir von Woche zu Woche feststellen, dass wir hinter den Aktivitätszielen herhinken. Denn wie sollen wir das hoch gesteckte Ergebnis-Ziel bis zum Jahresende schaffen, wenn wir nicht mal unsere Wochen-Aktivitäten hinbekommen?
Das wöchentliche Follow-Up dient dazu, dass jeder Teilnehmer Verantwortung übernimmt und die Ziele so steckt, dass sie erreichbar sind. Dadurch entsteht eine Teamdynamik und das Team lernt, dass alle gemeinsam durch die kleinen, konsequenten, täglichen Schritte das Ziel erreichen können. Sollte es zu Schwierigkeiten kommen, brauchen Sie sich nicht gegenseitig am Jahresende die Schuld zuzuweisen, warum das Ziel nicht erreicht wurde. Durch die beschriebene Vorgehensweise arbeiten Sie agil: Probleme werden frühzeitig sichtbar und Sie können mit Ihrem Team schnell an einer Lösung arbeiten, um das Projekt auf Kurs zu halten.
Umsetzungs-Erfolge im Vertrieb sind also kein Hexenwerk. Aus meiner Erfahrung haben Vertrieb und Sport viel gemeinsam. Es braucht nur ein verlässliches System, mit dem Sie die Dinge konsequent ins Tun bringen. Man kann Veränderungs-Management komplex und kompliziert machen. Mit vielen Modellen, Analysen und umfangreichen Projektstrukturen arbeiten. Am Ende lässt sich Veränderungs-Erfolg auf eine einfache Formel bringen: der Unterschied zwischen „Tun“ und „nicht tun“ ist: TUN. Mir hat die beschriebene Arbeitsweise damals geholfen, den Umsatz innerhalb von 4,5 Jahren zu ver-20-fachen. Mit dieser Formel kommen Sie garantiert ins TUN. Der Weg wird zwar nicht leicht. Aber er ist jetzt zumindest einfach.
Das Video ist aus meiner Youtube-Serie #CappuccinoFriday. Schauen Sie doch mal in meinen Kanal.
Gut ist, wenn es einfach ist
Woran erkennen wir, dass etwas wirklich gut ist? Die Amerikaner halten sich an den Leitspruch der Profi-Köche: ein Rezept ist dann gut, wenn es einfach ist. Wir Deutschen sehen es jedoch genau anders: es ist dann gut, wenn es möglichst kompliziert ist. Das habe ich am Beispiel eines börsennotierten Konzerns erlebt…
Keine Zeit zum Lesen? Dann hören Sie doch einfach rein. Gleich hier - oder auf SoundCloud oder iTunes.
Woran erkennen wir, dass etwas wirklich gut ist? Die Amerikaner halten sich an den Leitspruch der Profi-Köche: ein Rezept ist dann gut, wenn es einfach ist. Wir Deutschen sehen es jedoch genau anders: es ist dann gut, wenn es möglichst kompliziert ist.
Gesunder Menschenverstand ist zu banal
Ein Manager hat zwei Workshops mit mir erlebt und ist von den Inhalten begeistert. Seiner Meinung nach sollten diese Themen auch in seinem Unternehmen bekannt gemacht werden. Also empfahl er mich weiter an die Personal-Verantwortlichen des börsennotierten Konzerns, in dem er arbeitete. Mit ihnen traf ich mich, um über Führungskräfteentwicklung zu sprechen. Nachdem sich die beiden Ansprechpartner vorgestellt haben, möchten Sie mehr über mich erfahren.
Erste Frage: welche formalen Ausbildungen haben Sie, um Führungskräfte zu entwickeln? Meine Antwort: Keine Zertifikate, sondern berufliche Praxis und persönliche Erfahrung. Das sorgte für erstes Stirnrunzeln bei meinen Gegenübern.
Zweite Frage: welche Modelle verwenden Sie? Meine Antwort: gesunden Menschenverstand und möglichst einfache Tools. Ich erzählte, dass mir ein klares Ziel wichtig ist – und dann begleite ich Führungskräfte bei der Umsetzung. Antwort: „Ganz ehrlich, Herr Holzer – das ist mir zu banal. Andere Berater kommen mit komplexen Analyse-Modellen zu uns. Und unsere Führungskräfte sind Ingenieure, die brauchen analytische Modelle.“
Auszeichnungen machen noch keinen Erfolg
Was läuft da gerade schief? Ich verkniff mir, dass die Hälfte meiner Kunden aus dem technischen Umfeld kommt. Dass ich regelmäßig mit Führungskräften von Continental arbeite. Und mindestens drei Mal im Jahr beim Verband der Ingenieure (VDI) Seminare halte. Die Feedbacks all dieser Ingenieure und Akademiker liegen jedes Mal im weit überdurchschnittlichen Bereich. Doch wozu sollte ich mich rechtfertigen? Erstens habe ich dazu keine Lust. Und zweitens wäre es auch sinnlos, denn mein Gesprächspartner leidet unter dem Input-Virus.
Es zählt nicht so sehr, welche Wirkung erzielt wird. Viel wichtiger ist, welche schicke Methodik zum Einsatz kommt.
Eine Freundin von mir bewarb sich auf einen Geschäftsführer-Posten. Die Personalberatung machte mit ihr alle möglichen „Eignungstest“. Einer davon diente dazu, ihre „Leadership Signature“ zu identifizieren. Was für ein Schwachsinn. Natürlich überlegte sie sich ganz genau, welches Bild sie von sich abgegeben wollte. Und so wählte sie genau die Antworten aus, die zum vermeintlichen Idealbild passten. "Tun Sie alles dafür, um zu gewinnen?" oder "Hassen Sie es, zu verlieren?" -- hmmm, tue alles dafür, um zu gewinnen passt besser. Ihr Kommentar, als wir telefonierten: „Da muss ein Personalberater wohl seine Honorare durch komplexe Analyse-Tools rechtfertigen“.
Damit hat sie wohl recht. Denn diese ganzen formalen Dinge sind vielleicht in Einzelfällen hilfreich. Aber in vielen Situationen sind sie nur unnötig komplex und spielen ängstlichen Managern eine Scheinsicherheit vor.
Wirkungsvoll durch Vereinfachung
In der Start-Up-Szene gibt es den Begriff des Minimum Viable Product (MVP). Damit sich Gründer gar nicht erst hinter Ausreden verstecken oder in Aufschieberitis verstricken können, ist das Ziel, die kleinstmögliche Produktversion zu bauen. Sobald diese Minimalversion steht: raus damit in den Markt und testen. Mit dem Kundenfeedback wird dann weiter daran gearbeitet und optimiert.
Dieses Prinzip ist für viele Lebensbereiche hilfreich. Auch privat. Wenn beispielsweise Sport lange Zeit ein Fremdwort für Sie war, dann kaufen Sie sich nicht gleich Bücher, DVDs, buchen Sie nicht Trainerstunden und melden Sie sich auch nicht im Fitness-Studio an. Machen Sie doch erstmal einen ersten kleinen Schritt. Kaufen Sie sich Joggingschuhe und gehen Sie jeden Abend eine Runde um den Block. Nach einer Woche fangen Sie an zu joggen. Und nach einem Monat ergänzen Sie Ihr Programm durch Fitness-Training.
Egal vor welchem Problem Sie stehen: Suchen Sie nach der einfachen Lösung. Und wenn es sie noch nicht gibt, dann suchen Sie weiter. Es gibt immer eine Abkürzung. Und wenn es noch nicht einfach ist, haben Sie es nur noch nicht zu Ende durchdacht.
In Deutschland gilt leider immer noch: der Input ist dann gut, wenn er möglichst komplex ist. Doch wozu? Ich habe immer wieder erlebt, dass komplexe Gedanken ein einziges Problem haben: sie sind noch nicht zu Ende gedacht worden. Wenn man es nicht einfach sagen kann, dann ist es einfach noch nicht reif.
Wer die Dinge zu Ende denkt, macht sie einfach. Und gewinnt Klarheit. Durch Klarheit gewinnen wir Power. Mehr dazu in einer Folge aus meiner YouTube-Serie #CappuccinoFriday.
Trotz Digitalisierung: Service trennt die Spreu vom Weizen
Kürzlich begleitete ich meine Mutter in eine orthopädische Klinik. Wir fahren vor den Eingang und werden durch ein Hinweisschild aufgehalten: "STOP. Wir parken den Wagen für Sie". Tatsächlich. Wie in einem 5-Sterne-Hotel befindet sich vorm Eingang ein Stehpult, an dem uns schon ein freundlich lächelnder Mitarbeiter erwartet. Er nimmt den Schlüssel entgegen und bringt das Auto für uns in die Garage. Kosten: 2,- Euro pro Stunde.
Keine Zeit zum Lesen? Dann hören Sie doch einfach rein. Gleich hier - oder auf SoundCloud oder iTunes.
Kürzlich begleitete ich meine Mutter in eine orthopädische Klinik. Wir fahren vor den Eingang und werden durch ein Hinweisschild aufgehalten: "STOP. Wir parken den Wagen für Sie". Tatsächlich. Wie in einem 5-Sterne-Hotel befindet sich vorm Eingang ein Stehpult, an dem uns schon ein freundlich lächelnder Mitarbeiter erwartet. Er nimmt den Schlüssel entgegen und bringt das Auto für uns in die Garage. Kosten: 2,- Euro pro Stunde.
Kunden zu Fans machen
Jedes Unternehmen hat Kunden. Und jeder Kunde hat auch schon mal irgendwo in seinem Leben einen 5-Sterne-Service erlebt. Dazu muss er nicht in einem 5-Sterne-Hotel nächtigen oder diese orthopädische Klinik besuchen. Es reicht auch ein guter Kellner im Restaurant, der weiß, wie man einen unvergesslichen Abend bereitet: nie stören, aber immer in der Nähe, wenn der Gast etwas braucht. Oder ein kulanter Einzelhändler, der ohne große Diskussionen das Produkt zurücknimmt und das Geld erstattet – anstatt einen Gutschein auszuhändigen.
Kunden zu Fans machen – das gilt nicht nur im direkten Endkundengeschäft (B2C). Auch im gewerblichen Bereich (B2B) können Sie so punkten. Das hat beispielsweise der Werkzeugmaschinenbauer Trumpf verstanden. Dort nahm man sich Amazon als Vorbild. Sei es für einen Log-In-Bereich, in dem per Mausklick schnell und einfach bestellt werden kann. Bis hin zum Amazon Dash Button, den Sie sich zu Hause an den Kühlschrank pinnen können. Per einfachem Knopfdruck wird automatisch eine Bestellung ausgelöst, wenn zum Beispiel die Milch leer ist. Trumpf hat einen ähnlichen Button entwickelt, den Easy Order Button. Per Knopfdruck wird automatisch das nötige Ersatzteil geordert. Die verschiedenen Digitalisierungs-Maßnahmen haben im Ergebnis dafür gesorgt, dass Trumpf den Durchlauf einer Bestellung von 4 Tagen auf 4 Stunden verkürzen konnte.
Begeisterung statt Mittelmaß
Die Lösungen bei Trumpf haben mit meinem „Wir parken den Wagen für Sie“-Erlebnis in der Klinik etwas gemeinsam. Sie sorgen für Begeisterung. Doch was ist Begeisterung eigentlich? Für mich lässt es sich auf diese Formel verdichten:
Begeisterung = erbrachte Leistung – Erwartung des Kunden
Um zu begeistern, kommen wir also nicht darum herum, die Erwartung der Kunden zu übertreffen. Und das klappt nur, indem wir Spitzenleistung abliefern. Was soll auch die Alternative sein? Mittelmaß?
Die Haken der Spitzenleistung
Doch Spitzenleistung kommt nicht einfach so. Im Gegenteil, sie hat gleich mehrere Haken.
Haken 1: Spitzenleistung ist anstrengend. Es ist eben nicht die Standard-Nummer. Sondern die Extra-Meile. Das erfordert Energie: Nachdenken, in den Kunden versetzen, eigene Gewohnheiten hinterfragen, den Mund aufmachen, kritische Gespräche mit Kollegen führen, und und und. Und am Ende müssen Sie den geschmiedeten Plan auch noch umsetzen. Und zwar parallel zum anspruchsvollen Tagesgeschäft.
Haken 2: Spitzenleistung weckt Begehrlichkeiten. Es ist zwar ein macho-mäßiges Beispiel, aber daran wird die These sehr deutlich. Stellen Sie sich bitte vor, Sie sind Teil einer Männer-Clique, die gerne Fußball schaut. Und zwar am liebsten in einem gehobenen American Sports Restaurant. Sofern Sie diesen Text als Frau lesen, tun Sie bitte so, als wären Sie ein Mann. Nach einiger Zeit suchen Sie die Toilette auf. Und es verschlägt Ihnen die Sprache.
Denn erstmals erwartet Sie eine hübsche junge Dame im Vorraum, die Ihnen freundlich zulächelt und Sie begrüßt. Nachdem Sie von der Toilette wiederkommen, spendet sie Ihnen Waschlotion auf die Handflächen und trocknet Ihnen danach die Hände mit einem frischen Handtuch ab. Dem Angebot, dass sie Ihre Hände auch noch mit einer Creme massiert, können Sie nicht widerstehen.
- Frage 1: Wie oft werden Sie an diesem Abend noch die Toilette aufsuchen?
- Frage 2: Wie oft werden Sie Ihren Freunden von diesem Erlebnis erzählen?
- Frage 3: Werden Sie das Restaurant zukünftig regelmäßig besuchen?
Nach dieser begeisternden Toiletten-Erfahrung hat der Mann ein neues Lieblings-Restaurant und freut sich jedes Mal nicht nur aufs Essen. Ein paar Monate später. Ein Kumpel aus einer fremden Stadt ist zu Besuch. Abends gehen Sie mit ihm natürlich in Ihr Lieblings-Restaurant. Gleich zu Beginn suchen Sie die Toiletten auf. „Ich will mir nur die Hände vorm Essen waschen“ (ist klar...). Und als Sie im Vorraum stehen, steht dort... niemand.
Eigentlich kein Drama. Denn der Toiletten-Raum ist kein bisschen schlechter als der eines 5-Sterne-Hotels. Doch der persönliche Pflege-Assistent, der Sie die letzten Male begeistert hat, hat nun eine Erwartung in Ihnen geweckt. Sie hatten ihn – bis zur ersten Begegnung – zwar nie vermisst. Doch nachdem Sie es ein paar Mal erlebt haben, ist die Begeisterung zum neuen Anspruch geworden. Da dieser nun nicht mehr erfüllt wird, wurde die Begeisterungs-Idee zur Ärgernis-Keule – und Sie sind von der Toilette und dem Restaurant völlig enttäuscht.
Heißt: Wenn Sie es schaffen, Ihre Kunden mit einem neuen Service zu begeistern, mit dem er bis dato gar nicht gerechnet hat – wird er genau diese „Extra-Meile“ von Ihnen in Zukunft als neuen normalen Standard erwarten. Da auch andere Firmen und Branchen ständig ihren Service verbessern, steigen die Erwartungen selbst dann an, wenn Sie in Ihrem Unternehmen noch gar nichts verbessert haben. Kunden übertragen ihre Erfahrungen nämlich gerne von einer Branche auf die andere. Ich nenne dies die Verbesserungs-Falle.
Doch diese beiden Haken sollen keine Ausrede sein. Im Gegenteil: Sie sind die Antwort auf die Frage „Wann hat der Wandel mal ein Ende? Wir würden so gerne die ganzen Veränderungen mal konsolidieren.“ – Nie! Wer Kunden zu Fans machen will, muss sich kontinuierlich hinterfragen und verbessern, um zukunftsfähig zu bleiben.
Service ist eine Frage der Unternehmenskultur
Sie sollten also Service nicht dem Zufall überlassen. Doch wie können Sie es systematisch anpacken? Es gibt zwei Ansätze.
Der Erste: Service ist eine Frage der Haltung. Stellen Sie die Menschen mit der richtigen Haltung ein. Und sie werden von sich aus ein excellentes Service-Level vorleben. Diese Menschen haben es einfach im Blut, Kunden zu begeistern und sich immer wieder etwas Neues einfallen zu lassen. Von meinen Kunden höre ich jedoch regelmäßig, dass diese Haltung leider selten anzutreffen sei.
Doch da bin ich mir nicht so sicher. Denn ich erlebe in meinen Projekten immer wieder Aspekte einer Unternehmenskultur, die dafür sorgen, dass Mitarbeiter diese Spitzenleistungs-Haltung eingestellt haben. Verständlich. Wenn Sie sich schlecht behandelt fühlen, haben Sie auch keine Lust mehr, die Extrameile zu gehen.
Deswegen ist der zweite Ansatz: Service ist eine Frage der Unternehmenskultur. Mich interessieren vor allem zwei Dinge, wenn ich mit einem Unternehmen ein neues Veränderungsprojekt starte. Wie gehen Führungskräfte und Mitarbeiter miteinander und untereinander um? Was wird durch die bestehende Unternehmenskultur verstärkt?
Unternehmenskultur ist zwar vermeintlich „weicher“ Kram. Aber er beeinflusst das Verhalten der Menschen. Und das Verhalten der Menschen führt zu Erlebnissen für den Kunden. Und diese Erlebnisse sind dann entweder von Service, Spitzenleistung und Qualität geprägt – oder strotzen vor Mittelmaß, Gleichgültigkeit und Nicht-Qualität. Deswegen bezeichne ich Unternehmenskultur auch gerne als Arbeitskultur.
Ob der Klinikbetreiber in Zukunft das Auto nicht nur für seine Kunden einparkt – sondern auch noch saugt und wäscht, wird sich zeigen. Doch egal ob Klinik, Wirtschaftsunternehmen oder staatliche Institution – ob Privatkunden- oder Geschäftskunden. Service wird am Ende die Spreu vom Weizen trennen.
Also: Wie gehen Ihre Mitarbeiter miteinander um? Was wird durch Ihre Unternehmenskultur verstärkt?
Jeden Freitag erscheint eine neue Folge meines #CappuccinoFridays. Mehr dazu auf meinem Youtube-Kanal.
Wie wir achtsam den Moment verpassen
Die Digitalisierung wird uns noch viele ungeahnte Möglichkeiten eröffnen. Wir haben die Chance, dass unser Leben durch diese Technologien bereichert und vereinfacht wird. Aber wir sollten es nicht übertreiben, denn Digitalisierung ist keine Allheillösung. Vor lauter Technik dürfen wir vor allem nicht vergessen, worauf es beim Menschen ankommt...
Wie wir achtsam den Moment verpassen
Gestern war ich mal wieder an der European Business School, meiner Alma Mater. Es war Tag der offenen Tür und ich wurde eingeladen, einen Vortrag zu halten. Nach dem Vortrag saß ich mit einem Bekannten, der aktuell an der EBS studiert, auf einer Bank. Die Sonne schien, und unser Blick beobachtete den Rhein, der an uns vorbeifloss.
Er erzählte mir: „Kürzlich war ich am Schloss Neuschwanstein. Die Touristen liefen alle mit dem Smartphone rum und schossen zig Fotos vom Schloss. Sie hakten einfach ein Motiv nach dem anderen ab – und liefen so von Sensation zu Sensation.“
European Business School (Oestrich-Winkel)
Die Jagd nach digitalen Erinnerungen
Mal Hand aufs Herz: wie machen Sie das? Ich erwische mich immer mal wieder dabei, meinen Hund im Wald gleich sieben Mal zu fotografieren. Oder den Sonnenuntergang im Urlaub gleich 11 Mal. In meinem Smartphone haben sich so über 5.000 Fotos angehäuft. Wie oft schaue ich sie mir an? So gut wie nie...
Wir verhalten uns eben immer noch wie die Steinzeit-Menschen: als Jäger und Sammler. Das digitale Zeitalter bietet uns nahezu unendliche Möglichkeiten, diese Ur-Instinkte intensiv auszuleben. Außerdem reicht es uns nicht, einfach nur irgendwas zu haben. Wir wollen das Beste. Also versuchen wir, möglichst viel zu sammeln, in der Hoffnung, dass die perfekte digitale Erinnerung dabei ist.
Als Privatperson heißt die Beute Fotos, WhatsApp-Posts, Facebook-Freunde, Follower, Likes und Kommentare. Die Beute der Unternehmen trägt den Namen „Daten“.
Beruflich wie privat gilt: Hauptsache sammeln.
Digitalisierung raubt den Zauber des Moments
An meiner Uni erzählte der Student weiter: „Die Menschen haben zwar im Smartphone die top Schnappschüsse. Dazu müssten sie jedoch nicht extra nach Neuschwanstein fahren. Solche Fotos könnten sie sich im Internet anschauen. Das was ihnen fehlt ist, die Atmosphäre vom Schloss vor Ort einfach zu genießen“.
An diesem Gedanken ist viel Wahres. Letztes Jahr habe ich mit meiner Frau einige Konzerte besucht: Guns n‘ Roses, Aerosmith, Zucchero, Robbie Williams. Anfangs habe ich einige Momente mit dem Smartphone gefilmt. Und was passierte? Meine Aufmerksamkeit richtete ich auf das Handy – anstatt auf den Künstler und sein Konzert. Ich achtete mehr auf die richtige Perspektive und dass kein Kopf des Vordermanns auf dem Bild war, als die Magie des Augenblicks zu genießen. Im Ergebnis hatte ich dann zwar Fotos und Videos, die mir zeigen, wie das Konzert aussah. Aber ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, wie sich das Konzert anfühlte.
Das gleiche erlebe ich in Unternehmen. Beispiel Versicherung. Diese Branche hat in Saus und Braus gelebt und ist in der Vergangenheit punktuell über die Stränge geschlagen. Als Konsequenz wird sie aktuell reguliert. Heißt: viele Formulare. Das Ganze wird dann gleich digitalisiert, damit man alles messen, auswerten und am besten noch vorhersehen kann. Im Ergebnis erlebt man als Kunde einen digitalisierten Prozess, durch den man sich mit dem Berater auf dem Tablet-Computer klickt.
Doch wo bleibt der Zauber des Moments? Anstatt sich auf den Kunden zu konzentrieren und nicht nur das zu hören, was der Kunde sagt, sondern auch das, was er nicht sagt – starren Berater und Kunde auf den Computer. Spätestens wenn dann ein Feld nicht auszufüllen ist oder das Programm abstürzt, hat das Verkaufsgespräch jede Magie verloren.
Es gibt Dinge, die können wir nicht messen
In meinen Seminaren erlebe ich immer wieder Menschen, die versuchen, jedes Wort mitzuschreiben, das ich erzähle. Notizen und Fotos von Flipcharts sind sinnvoll. Sie unterstützen unsere linke Gehirnhälfte dabei, mit Struktur, Logik und Verstand die Dinge zu ergründen und uns zu merken.
Aber es gibt noch eine andere Wahrheit. Nämlich was passiert außerhalb Ihrer bewussten Wahrnehmung? Welche Gefühle löst ein Gedanke in Ihnen aus? Dieses „unbewusste“ Lernen halte ich für mindestens genauso wichtig. Und deswegen ist es bei Seminaren, in denen Sie auch Ihre Persönlichkeit entwickeln wollen, hilfreich, nicht nur auf Ihre Notizen zu achten. Sondern den Dingen auch einfach mal ihren Lauf zu lassen.
Oder Sie haben einen offenen, intensiven Moment im Kundengespräch. Wollen Sie jetzt wirklich mitschreiben, was er Ihnen zu sagen hat? Und damit alles zerstören, was an zwischenmenschlicher Beziehung möglich gewesen wäre? Absoluter Quatsch. Wenn ich einen Unternehmer zum ersten Mal treffe und ihn in seiner Firma besuche, habe ich nichts dabei. Keinen Computer, keine Präsentation, keine Unterlagen. Ich will ihm einfach nur begegnen, intensiv zuhören, mich für ihn interessieren und ein gutes Gespräch führen. Meine Notizen mache ich nach dem Treffen.
Und wie sieht es zu Hause aus? Sie sitzen auf dem Sofa, fummeln im Handy rum oder schauen Fernsehen – und Ihr Kind kommt rein. Hören Sie dann nur mit einem Ohr zu, während Sie weiter in die digitale Welt starren – oder drücken Sie auf Pause und schenken Ihrem Kind die volle Aufmerksamkeit? Sie können auf beide Arten zuhören, aber emotional wird es bei Ihrem Kind unterschiedlich ankommen.
Achtsamkeit und Digitalisierung – eine Frage der Dosis
Die Digitalisierung wird uns noch viele ungeahnte Möglichkeiten eröffnen. Wir haben die Chance, dass unser Leben durch diese Technologien bereichert und vereinfacht wird. Aber wir sollten es nicht übertreiben, denn Digitalisierung ist kein Allheilmittel. Vor lauter Technik dürfen wir vor allem nicht vergessen, worauf es beim Menschen ankommt: Emotionen, Gefühle, Passion, Leidenschaft und Herzblut.
Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass es eine technische Alternative gibt, die meiner Frau sagt: „Ich liebe Dich“. Da muss ich mir schon selber etwas einfallen lassen, was den Moment magisch und emotional macht. Und das will ich auch. Denn ich will Digitalisierung nur als Bereicherung in meinem Leben haben – nicht als Ersatz.
Verstehen Sie mich bitte richtig: Natürlich werden Sie auch mal durch eine digitale Innovation für emotionale Überraschungen sorgen und Ihr Gegenüber begeistern. Aber ich gehe jede Wette ein: wenn Sie nicht achtsam mit der Technik sind, sondern achtsam den Moment mit Ihrem Mitmenschen verbringen, ihm zuhören und auf ihn eingehen – wird dies viel häufiger magisch sein.
Jeden Freitag erscheint eine neue Folge meines #CappuccinoFridays. Mehr dazu auf meinem Youtube-Kanal.
Kampf dem Aufgaben-Tornado
Meetings, Telefonate, eMails, Kundenbesuche, ... Im modernen Arbeitsleben werden wir förmlich zugedröhnt mit Arbeit. Trotz Maschinen und Computer haben wir es noch nicht geschafft, uns von der Arbeit zu befreien. Im Gegenteil: die Arbeit wird agiler, schneller und vor allen Dingen immer mehr. Wie Sie im Erfolgsrausch selbstbestimmt bleiben, erfahren Sie in meinem Blog.
Meetings, Telefonate, eMails, Kundenbesuche, ... Im modernen Arbeitsleben werden wir förmlich zugedröhnt mit Arbeit. Trotz Maschinen und Computer haben wir es noch nicht geschafft, uns von der Arbeit zu befreien. Im Gegenteil: die Arbeit wird agiler, schneller und vor allen Dingen immer mehr. Für das Magazin StartupValley habe ich dazu einen Artikel geschrieben. Thema: Wie Sie im Erfolgsrausch selbstbestimmt bleiben. Lesen Sie doch mal rein.
Gleichberechtigung der Frau - leider falsch verstanden
Unsere Gesellschaft wandelt sich. Auch bei der Frage, wie wir mit Mann und Frau umgehen. Das ist auch bitter nötig. Nur leider verselbständigt sich der Verbesserungskurs ins Absurde. Von Bank-Formularen bis hin zur Anpassung der Nationalhymne. Für mich sind das die Auswüchse einer neurotischen Gesellschaft, die nicht mehr den Blick aufs Wesentliche hinbekommt.
Unsere Gesellschaft wandelt sich. Auch bei der Frage, wie wir mit Mann und Frau umgehen. Das ist auch bitter nötig. Nur leider verselbstständigt sich der Verbesserungskurs ins Absurde. So wurde eine geschlechterneutrale Sprache für die deutsche Nationalhymne diskutiert. Dort soll es dann „Heimatland“ statt „Vaterland“ und „couragiert“ statt „brüderlich“ heißen. An anderer Stelle klagte eine Dame vor Gericht, dass Sie auf den Formularen ihrer Bank nicht mit „Kunde“, sondern mit „Kundin“ angesprochen werden wolle. Für mich sind diese beiden Beispiele Auswüchse einer neurotischen Gesellschaft, die nicht mehr den Blick aufs Wesentliche hinbekommt.
Bevor Sie den Artikel nicht zu Ende lesen und mich gleich wütend in die Ecke der „frauenfeindlichen Männer“ stellen, kann ich Sie beruhigen. Ich mag Frauen. Arbeite gerne mit ihnen zusammen. Bin gerne und glücklich verheiratet. Meine Haltung zu den Geschlechtern ist einfach: Gleichberechtigung und gleiche Rechte für alle — nur lasst mich bitte mit den ganzen Partikularinteressen in Ruhe. Und doch gibt es für mich durchaus auch nachvollziehbare Argumente, weswegen wir über einen reflektierten Sprachgebrauch diskutieren sollten — bevor ich zum meinem „Aber...“ bezüglich der ganzen Gender-Sprach-Debatte komme.
Am Anfang war das Wort
Dieser Satz stand schon in der Bibel. Worte haben eine unglaubliche Wirkung. Das habe ich schmerzlich gespürt, als ich an der European Business School studiert habe. Es handelt sich dabei um eine Privatuni und ich musste die Studiengebühren mit Hilfe eines Kredits finanzieren. Als ich während der Semesterferien ein Praktikum machte, um Geld zu verdienen – während meine Freunde an staatlichen Unis den Sommer und das Leben genossen – sank meine Motivation gegen Null. Ich schaute in den Kreditvertrag und lernte: wer schreibt der bleibt. Denn dort stand: Sollte dieses Studium aus welchen Gründen auch immer vorzeitig beendet oder abgebrochen werden, so ist dieses Darlehen innerhalb von 30 Tagen fällig.
Worte haben eine Bedeutung. Deswegen sollten wir sorgsam und achtsam unsere Worte wählen. Denn sie können für unseren Gegenüber schmerzhaft, verletzend oder diskriminierend sein.
Gleichberechtigung: es gibt Handlungsbedarf
Die Baustellen der Gleichberechtigung, auf denen wir als Gesellschaft Handlungsbedarf haben, scheinen groß zu sein. So gibt es immer noch Unterschiede in der Bezahlung von Mann und Frau. Sie liegen in Deutschland laut Statistischem Bundesamt bei 22 Prozent. Oder doch nur bei sechs Prozent? Die Statistiker nennen beide Zahlen. Und sind sich selbst nicht so sicher. Dazu schreibt das Statistische Bundesamt: „Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der bereinigte Gender Pay Gap möglicherweise geringer ausgefallen wäre, wenn weitere lohnrelevante Einflussfaktoren für die statistischen Analysen zur Verfügung gestanden hätten. So lagen beispielsweise zu den familienbedingten Erwerbsunterbrechungen keine Informationen vor.“
Da fällt mir nur der Leitsatz ein: Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Je nachdem, welche Meinung Sie haben, werden Sie auch die passende Statistik finden, die Ihren Standpunkt untermauert.
Gleichberechtigung: Ja! Aber bitte nicht übertreiben.
Die Gender-Diskussion, die ich in den Medien mitbekomme, sind häufig Wort-fokussiert. Doch was bringen politisch korrekte Worte, wenn die Taten völlig anders aussehen? Der deutsche Volksmund weiß schon lange: „Worte sind Zwerge, Taten sind Berge“.
Ich kann nicht verstehen, weswegen es für eine Frau wichtig ist, auf Formularen mit Kunde oder Kundin angesprochen zu werden. Entscheidend ist doch die Frage, wie wertschätzend sie vom Kundenberater behandelt wird. Von mir aus können alle Banken ihre Formulare ändern und überall „Kundin“ drauf schreiben. Für mein Selbstwertgefühl als Mann wäre das kein Nachteil. Eher würde ich mich fragen, ob die Bank zu viel freie Zeit hat, um über solche Kleinigkeiten nachzudenken.
In den Diskussionen höre ich oft die Forderung, dass es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau geben darf. Und deswegen bräuchten wir eine gleich-stellende Sprache. Doch warum wurden dann Frauen-Parkplätze eingerichtet? Mit diesem Begriff grenzen wir die Frau bewusst vom Mann ab. Handelt es sich etwa um Rosinenpickerei? Nach dem Motto: Ich will wie ein Mann behandelt werden. Aber wenn es für mich von Vorteil ist, dann darf ich als Frau wieder anders (= bevorzugt) behandelt werden.
Übertreibung führt zum Gegenteil
Aus Sicherheitsgründen verstehe ich, dass ein Frauenparkplatz nah am Ausgang liegt, mit Kameras bewacht wird. Aber die Frauen-Diskussion geht weit über das Sinnvolle hinaus. Die Forderung nach Kunde / Kundin-Formularen, gender-angepasster Nationalhymne und vielem mehr sind für mich absurd. Und sie sind auch für die Frauen gefährlich.
Bitte verstehen Sie mich richtig: Ich halte die Bewegung, Mann und Frau wirklich gleich zu berechtigen für sinnvoll und überfällig! Aber wenn dieser Kampf auf zu vielen Nebenkriegsschauplätzen ausgetragen wird, besteht die Gefahr, dass die sinnvolle Diskussion ins Lächerliche gezogen wird.
Wahrheit ist eine Linie
Wenn ich das Für und Wider einer gender-gerechten Sprache für mich abwäge, dann ist es so wie immer im Leben: es gibt keine einfachen Wahrheiten. Und vor allem keine Punktwahrheiten, im Sinne von „das ist richtig“ oder „das ist falsch“. Vielmehr ist Wahrheit eine Linie. Es gibt viele Wahrheiten, die irgendwie alle richtig sind.
So halte ich es für wichtig, über unsere Wort- und Sprachgewohnheiten nachzudenken. Aber bitte nicht überall und ständig. Denn worum geht es eigentlich? Nicht um die Worte, sondern um die Taten. Es geht nicht um Mann und Frau. Sondern darum, dass wir alle Menschen fair behandeln. Unabhängig von Geschlecht. Aber auch unabhängig von Nationalität, Hautfarbe, Hobbies, Sprache, ...! Es geht allgemein darum, dass sich nicht Dominanz ungefragt durchsetzt und die Zurückhaltenden erniedrigt. Für mich ist das Ziel der ganzen Gender-Thematik eine gesunde Streitkultur, in der wir hart in der Sache reden, und fair zum Menschen bleiben.
Die Voraussetzung für diesen gesunden Umgang miteinander ist Respekt. Das bedeutet, die Souveränität des anderen anzuerkennen, dass er anders ist, denkt, fühlt und handelt als ich. Gelebter Respekt ist das, was wir zwischen Mann und Frau brauchen. Und da reichen keine Worte. Die stehen schon in unserem Grundgesetz: Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Das was wir jetzt brauchen sind Menschen, die diesen Worten endlich Taten folgen lassen.
Sorgen - und der erfolgreiche Umgang mit echten Problemen
Die Stimmung an Ihrem Arbeitsplatz ist unerträglich, aber Sie machen sich Sorgen was passiert, wenn Sie es ansprechen. Sie wollen auf Kohlenhydrate verzichten und mehr Sport machen, aber das könnte ja ganz schön hart werden … Sie möchten ferne Länder bereisen, aber vielleicht kommen Sie dort gar nicht zurecht. Sorgen sind eine gefährliche Falle.
Sorgen — und der erfolgreiche Umgang mit echten Problemen
Die Stimmung an Ihrem Arbeitsplatz ist unerträglich, aber Sie machen sich Sorgen was passiert, wenn Sie es ansprechen. Sie wollen auf Kohlenhydrate verzichten und mehr Sport machen, aber das könnte ja ganz schön hart werden … Sie möchten ferne Länder bereisen, aber vielleicht kommen Sie dort gar nicht zurecht.
Das ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt des unerschöpflichen Sorgen-Buffets, an dem wir Menschen uns Tag für Tag bedienen.
„Zurecht!“, werden Sie jetzt vielleicht sagen. In der heutigen schnelllebigen und unsicheren Zeit gibt es unzählige Gründe, sich Sorgen zu machen – das können Sie jeden Tag in den Medien sehen. Steigende Kriminalitätsraten, drohende Jobverluste aufgrund der Digitalisierung, hohe Scheidungsrate …
Stopp! Das mag zwar auf den ersten Blick logisch erscheinen. Ist es aber nicht.
Die lähmende Angst
Sorgen macht sich jeder von uns. Mal mehr, mal weniger. Und genau das ist das Problem. Sorgen kommen nicht einfach so. Sorgen machen Sie sich. Sie entstehen in Ihrem Kopf und sind auch nur dort existent. Und was da entsteht, ist nichts anderes als Angst vor der Zukunft.
Sorgen sind Ängste vor dem, was kommen könnte. Sorgen beziehen sich nicht auf das Hier und Jetzt, sondern auf das Vielleicht. Auf das, was in der Zukunft vielleicht sein könnte – doppelter Konjunktiv! Dieses Vielleicht der Zukunft holen wir uns aber in das Hier und Jetzt, indem wir uns Sorgen machen. Und dann macht das einigen Menschen so viel Angst, dass sie lieber das heutige Elend erdulden anstatt etwas zu verändern.
Genau wie Theo, den ich bei einem Segelkurs auf Elba kennengelernt habe. Theo war total unzufrieden mit seinem Job als Rechtsanwalt und in seiner Beziehung war auch schon lange die Luft raus. Über eine Veränderung hat er trotzdem nicht mal nachgedacht. Schließlich könnte es dann vielleicht noch schlimmer werden als jetzt. Allein die Angst vor der Zukunft hat ihm also den gesamten Mut geraubt, um sich zu einer Veränderung zu entschließen!
Vielleicht haben Sie sogar Verständnis für Theo, denn ohne Job und ohne Frau zu sein ist nunmal schlimmer, als hin und wieder Zoff oder einen nervigen Arbeitskollegen zu haben. Aber woher weiß Theo denn, dass er nicht mit einer anderen Frau nochmal seinen zweiten Frühling erleben kann – oder einen besseren Job in einem anderen Unternehmen bekommt? Er probiert es ja nicht mal!
Sorgen sind unnötige Energiefresser
Ich behaupte nicht, dass eine Veränderung keine Schwierigkeiten mit sich bringt. Im Gegenteil. Nach der Entscheidung, etwas zu verändern, befinden Sie sich auf einem Weg, der durchaus auch sehr hart werden kann. Denn auf diesem Weg geht es darum, die Entscheidung umzusetzen und durchzuhalten – auch wenn es mal schwierig und anstrengend wird.
Die Umsetzung braucht Kraft und Energie. Und gerade deshalb finde ich es wichtig, keine Energie in die Angst vor all den „könnte-vielleicht-Horrorszenarien“ zu verschwenden, die es ohnehin nur in Ihrem Kopf gibt. Heben Sie sich Ihre Energie auf, bis Sie wirklich vor Schwierigkeiten stehen. Denn welche Schwierigkeiten Ihnen echte Probleme bereiten, das erfahren Sie erst, wenn es soweit ist. Und meist sind es nicht die, die Sie in Ihrem Kopfkino gesehen haben.
Also – hören Sie auf, sich Sorgen zu machen, was alles schieflaufen könnte. Fokussieren Sie Ihre Gedanken lieber darauf, was alles gut gehen kann. Und arbeiten Sie daran, dass es auch tatsächlich gut wird.
Aufgeben oder durchhalten - die Angst darf nicht entscheiden
Ich habe einen Freund, der sich monatelang über die Strukturen in einem Konzern, in dem er als Führungskraft arbeitete, beschwert hat. Irgendwann platzte ihm der Kragen und er hat sich selbstständig gemacht. Großartig! Den Mut muss man mit Ende 40 erstmal haben. Sechs Monate später. Ich erhielt eine SMS von ihm, die mich sprachlos machte...
Keine Zeit zum Lesen? Dann hören Sie einfach zu. Unten klicken oder iTunes besuchen.
Ich habe einen Freund, der sich monatelang über die Strukturen in einem Konzern, in dem er als Führungskraft arbeitete, beschwert hat. Irgendwann platzte ihm der Kragen und er hat sich selbstständig gemacht. Großartig! Den Mut muss man mit Ende 40 erstmal haben.
Sechs Monate später. Ich erhielt eine SMS von ihm: „Habe Job als Geschäftsführer bei Firma XY angenommen“. Er hat sich also wieder in einem Konzern anstellen lassen. Meine Antwort an ihn: „Du hattest den Mut, dich selbstständig zu machen. Aber den Mumm, durchzuhalten, wenn es hart auf hart kommt, hattest du nicht.“ Er: „Hört sich doof an, ist aber leider so.“
Hand aufs Herz: Wahrscheinlich geht es Ihnen so wie mir, dass auch Sie ins Zweifeln kommen, wenn es mal schwierig und zäh wird. Obwohl Sie sich etwas fest vorgenommen haben, spielen Sie mit dem Gedanken, aufzugeben. Und wahrscheinlich haben Sie auch schon ein Vorhaben abgebrochen, als es nicht so schnell, nicht so gut lief wie geplant. Doch es gibt Situationen, in denen Aufgeben leider keine Lösung ist, sondern nur das Problem verschärft …
Der Todesstreifen der Veränderung
Denken Sie mal zurück, als Sie das letzte Mal etwas angefangen und dann doch abgebrochen haben:
- das Tüfteln an einer Produktinnovation,
- ein Veränderungsprojekt im Unternehmen umsetzen,
- das Budget in der Firma endlich mal erreichen,
- Englisch lernen,
- Sport machen,
- die Beziehung mit Ihrem letzten Lebenspartner, von dem Sie sich trennten, als es nicht „rund“ lief
- oder der Neujahrsvorsatz endlich mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen ...
Es begann mit Euphorie und versickerte irgendwann still und heimlich im Tagestrubel. Und mit Sicherheit hatten Sie zahlreiche Gründe, Ihr einst so zielstrebiges Vorhaben abzubrechen.
So wie mein Freund, der seine Selbstständigkeit beendete, weil es zu hart, zu anstrengend war, alles zu langsam vorwärts ging und der Erfolg zu lange auf sich warten ließ – während die Miete und die Unterhaltszahlungen für seine Kinder sich immer enger um seinen Hals wickelten. Schließlich muss das Essen irgendwie auf den Tisch kommen. Ich könnte sogar fast verstehen, wenn Sie Verständnis für meinen Freund hätten – aber eben nur fast.
Zu Erfolg gehören zwei Dinge. Erstens, entscheiden. Zweitens, umsetzen. Zwar hadern Menschen immer mal wieder dabei, Entscheidungen zu treffen, aber den meisten fällt dieser erste Schritt doch vergleichsweise leicht. In einem Anflug von Motivation und Euphorie steht der Plan: Mehr Sport machen. Neues Veränderungsprojekt auf den Weg bringen. Englisch lernen.
Doch wenn Sie eine Entscheidung getroffen haben und sich dann auf den Weg der Umsetzung machen, lauert bereits der wahre Feind jeder Veränderung: das Tal der Tränen. Und genau hier ist mein Freund mit seiner Selbständigkeit kläglich verkümmert.
Aus meiner Erfahrung ist der alles entscheidende Faktor, ob Sie eine Entscheidung erfolgreich umgesetzt bekommen oder nicht, die Frage, ob Sie in der Lage sind, sich durch dieses Tal der Tränen durchzukämpfen. Ob Sie Ihr Ding konsequent durchziehen. Komme was wolle. Und diesen Mumm haben die meisten leider nicht. Sie bleiben im Tal der Tränen stecken und geben auf.
Mit angezogener Handbremse
Diesem Tal der Tränen ist jeder schon im Leben begegnet. Wenn ich Veränderungsprojekte in Unternehmen begleite, spreche ich viel mit den Mitarbeitern und Führungskräften. Dabei habe ich die Erfahrung gemacht, dass allein schon die Sorge davor, dass das Tal der Tränen kommt, die Menschen blockiert.
Es ist dieser Nebel, der auf dem Weg liegt, da keiner so genau weiß, was auf die Menschen zukommt. So entsteht Angst: die Angst vor den Konsequenzen der Veränderung. Sie fürchten sich vor den Problemen, die im Tal der Tränen kommen könnten, noch bevor sie überhaupt dort angekommen sind.
Sie haben Angst vor den Szenarien, die in der Zukunft passieren oder eben nicht passieren, Sie fürchten sich davor, nichts Erfüllendes am Ende Ihrer Reise zu finden, Sie haben Angst, beruflich nicht Fuß zu fassen. Kurzum: Sie haben Angst, der Zukunft nicht gewachsen zu sein. Und es scheint manchmal einfach leichter, umzukehren – den notwendigen Veränderungen auszuweichen und einfach im gewohnten Status Quo zu verharren. Aber das ist keine Option!
Mut bedeutet, dass Dir etwas anderes wichtiger ist, als Deine Angst
Aus meiner Erfahrung sind Frauen ehrlich: sie sagen, dass sie Angst haben. Männer umschreiben das: sie haben Respekt vor der Situation. Wie auch immer – ich kann Ihre Angst bzw. Ihren Respekt nachvollziehen, denn es ging mir genauso. Und zwar schon oft im Leben.
Am intensivsten habe ich diese Angst gespürt, als ich damals aus der Private Equity Firma ausgestiegen bin. Da war auf einmal kein Plan, kein gefüllter Kalender mehr, kein Horizont, wo die Reise hingehen soll. Und mich hat die Angst gepackt, die Angst vor der Zukunft. Was werde ich beruflich machen? Wie finde ich neue Kunden? Wie soll es weitergehen?
Die ersten Wochen ging ich nicht aufrecht, sondern taumelte eher vorwärts. Aber das ist das Entscheidende: Schritt für Schritt durch das Tal der Tränen weitergehen. Die Hindernisse verschwinden nicht, indem Sie stehen bleiben. Bei mir war das Leben mit Hindernissen sehr spendabel. Ich musste drüberklettern, sie überspringen oder sie durchbrechen. Trotz Angst, weitermachen. Egal wie – Hauptsache durch das Tal der Tränen kommen.
Wer fleißig ist, wird mit Glück belohnt
Anfangs suchte ich gierig nach der schnellen Lösung. Doch auf dem Weg lernte ich, mein Urvertrauen wieder zu gewinnen. Das Vertrauen, dass wir nicht alles immer steuern und kontrollieren können – sondern dass das Leben uns manchmal „von alleine“ den richtigen Weg weist. Indem der richtige Mensch, der richtige Gedanke, der richtige Moment plötzlich auftaucht und wir Kraft und Zuversicht gewinnen und gleich einen ganzen Satz nach vorne machen. Mir ist dieser Weg durch das Tal gelungen. Er war zwar nicht angenehm, aber rückblickend kann ich Ihnen sagen: Ich bin daran gewachsen. Und Sie werden das auch!
Im Prinzip haben Sie nur eine Wahl:
- Wenn in Ihrem Leben alles super ist – und Sie im Status Quo einfach sitzen bleiben, verwandelt sich Ihr Paradies irgendwann von alleine in ein Tal der Tränen – oder etwas derber, dafür aber konkreter gesprochen: in einen Haufen Mist. Die Firma will Sie auf einmal loswerden. Ihr wichtigster Kunde kündigt und wechselt zum Wettbewerber. Ihrer vernachlässigten Beziehung geht die Glut verloren und Ihr Partner flieht in eine Affäre. Die Digitalisierung rationalisiert Ihren Arbeitsplatz weg. Veränderungen sind unaufhaltsam. Sie kommen. Auch zu Ihnen.
- Wenn die Veränderungen schon zugeschlagen haben und Sie bereits im bildlichen Misthaufen sitzen, wo Sie alles ätzend und nervig finden oder es einfach nicht so läuft, wie Sie es gerne hätten, dann bleibt Ihnen nur der Aufbruch in die Veränderung. Doch der Weg zur Lösung führt Sie ins Ungewisse, wo jeder Schritt eine Veränderung, die unbekannte Folgen hat, bedeutet.
Kurzum: das Tal der Tränen gehört zum Lebensweg dazu. Also weichen Sie ihm nicht aus. Stellen Sie sich ihm!
Der Wunsch nach Spaß steht Zielen im Weg
Ein leichter Weg zu anvisierten Unternehmenszielen? Selbstverständlich. Alles, was Sie dafür brauchen, steht in jedem guten Managerhandbuch über Work 4.0, Empowerment und Co. Und das Allerbeste daran: Dieser Weg wird garantiert kinderleicht – egal, um welches Ziel es sich handelt.
Keine Zeit zum Lesen? Dann einfach hören...
Ein leichter Weg zu anvisierten Unternehmenszielen? Selbstverständlich. Alles, was Sie dafür brauchen, steht in jedem guten Managerhandbuch über Work 4.0, Empowerment und Co. Und das Allerbeste daran: Dieser Weg wird garantiert kinderleicht – egal, um welches Ziel es sich handelt. So jedenfalls die Botschaft vieler Ratgeber. Nicht verwunderlich, schließlich wollen wir Menschen Anstrengungen, wenn möglich, vermeiden – das Leben ist doch sowieso schon anstrengend genug.
Doch die Sehnsucht nach dem leichten Weg zum Erfolg ist nicht nur naiv – sondern vor allem gefährlich. Denn sie lässt uns das vermeiden, was zum Erfolg gehört wie Schatten zum Licht: Anstrengung, Konsequenz und Härte.
Ein Tischkicker führt nicht zum Ziel
Klar ist es angenehmer und für unser Gehirn geeigneter, Spaß zu haben. Und manchmal finden Sie sogar Abkürzungen auf dem Weg zu Ihrem Ziel, die vielleicht weniger mühsam erscheinen. Zumindest anfangs. Doch oftmals entpuppt sich die scheinbare Abkürzung als ein böser Umweg.
Ab und an halte ich Gastvorträge an Universitäten. Dort werden mir immer wieder Umwege als Abkürzung verkauft. Studenten erzählen mir, dass sie später einmal ein eigenes Unternehmen gründen, jedoch zunächst Erfahrungen in einem großen Konzern sammeln möchten. Als Angestellter.
Ich frage mich dann jedes Mal: Wie bitteschön soll jemand in einem hierarchischen System, das geprägt ist von Regeltreue, Gehorsam und Political Correctness, lernen, wie man als Unternehmer Regeln bricht und Innovationen vorantreibt? Die vermeintliche Abkürzung „Angestellter im Konzern“ stellt sich spätestens mit der eigenen Unternehmensgründung nur als unnötigen Umweg heraus.
Denn wie heißt es doch so schön: Im Leben bekommen Sie nichts geschenkt. Entsprechend sind Sie gefordert, Härte gegen sich selbst an den Tag zu legen.
Sonderlich verführerisch hört sich das nicht an, keine Frage. Da halten wir uns doch lieber an die Maxime: Spaß muss das Leben machen und natürlich auch die Arbeit. Und zwar sowohl Führungskräften als auch Mitarbeitern. Also wird hier ein Tischkicker im Unternehmen aufgestellt und dort eine Rutsche installiert – in der Annahme, dass durch diesen Fun die gemeinschaftliche Leistung verbessert wird. So ein Schwachsinn! Denn nur mit Spaß und Freude erreichen Sie niemals Ihre großen Ziele.
Ziele? Nichts leichter als das
Stattdessen bin ich der Überzeugung, dass große Ziele nur dann Realität werden, wenn wir uns mit Disziplin und Härte auf den Weg machen. Was bei diesem Vorgehen hart ist: dass Sie den Weg zu Ihrem Ziel fokussiert und konsequent durchziehen.
Als ich beispielsweise anfing, neben meiner Beratertätigkeit Vorträge zu halten, fand ich schnell Geschmack daran. Obwohl ich eigentlich keine Angestellten mehr haben wollte, brauchte ich jemanden, der sich um diesen neuen Bereich in meinem Leben kümmert. Also traf ich mich mit einem Bekannten aus alten Zeiten. Ich hatte ihn als absolutes Vertriebsass kennengelernt. Bei einem Abendessen fragte ich ihn: „Ich will meine Arbeit als Vortragsredner zu einer tragenden Säule ausbauen. Was ist wohl die beste Strategie, um das zu schaffen?“ Er überlegte nicht eine Sekunde. „TAM.“
Ich schaute ich verdutzt an. Er erklärte: „Tägliche Arbeits-Methodik. Einfach kontinuierlich neue Kontakte im Markt machen. Ich rufe jeden Tag 16 potenzielle Interessenten an. Plus Wiedervorlagen. Fünf Tage in der Woche, komme, was wolle. So generiere ich dir im Jahr rund 1000 Kontakte zu Leuten, die dich bisher noch nicht kennen.“ Alles klar, dachte ich. Das ist mein Mann. Fokussiert und konsequent. So wird das klappen.
Vom Schein zum Sein
Ich glaubte an meinen Bekannten, an seine Haltung und seine Disziplin. Ich glaubte an das Gesetz der TAM. Und ich gab ihm den notwendigen Freiraum, den er mit Verantwortung füllte. Er zog es durch. Und nach nur zwei Jahren generierte ich einen erheblichen Anteil meines Umsatzes durch Vorträge.
Dieses Beispiel machte mir nochmals sehr deutlich, dass es keinen Kuschelkurs zum Erfolg gibt. Es ist klar, dass Ihnen Ihr Thema Spaß machen sollte, so dass Sie mit Leidenschaft zur Sache gehen. Aber Menschen können nur dann etwas in ihrem Leben bewirken, wenn sie neben ihrer Leidenschaft auch konsequent vorwärtsgehen. Wenn sie den Preis zahlen, indem sie Hindernisse überwinden und fähig zur Härte im Umgang mit sich selbst, Problemen und Herausforderungen sind. Nur so bewirken sie etwas im Leben.
Die Belohnung wartet am Gipfel: Sie erreichen auf einmal Ihre Ziele. Da der Weg zum Ziel anstrengend war, wissen wir die Erfolge auch viel besser zu würdigen. Und dann, wenn Sie Erfolg haben, passiert etwas Magisches: die ganze Anstrengung macht auf einmal auch noch Spaß ;-)
Das Geheimnis erfolgreicher Beziehungen
Wer die rosarote Brille abnimmt, erkennt früher oder später, dass der Partner vielleicht doch nicht so perfekt ist. Zeit für einen Schlussstrich? Für mich nicht!
Wer die rosarote Brille abnimmt, erkennt früher oder später, dass der Partner vielleicht doch nicht so perfekt ist und man in einigen, vielleicht sogar sehr wichtigen Punkten unterschiedliche Ansichten und Vorstellungen hat.
Zeit für einen Schlussstrich? Für mich nicht! Warum? Das lesen Sie hier.
Klartext kann man nicht in Watte verpacken
Überall zeigt sich das gleiche Symptom: der Gemocht-Werden-Wollen-Virus. Ich bin jedoch der Meinung, dass man Klartext nicht in Watte verpacken kann. Denn ...
Keine Zeit zum Lesen? Dann einfach im Podcast hören:
Egal ob auf Facebook, beim Mittagstisch mit Kollegen oder im Meeting mit dem Chef – überall zeigt sich das gleiche Symptom: der Gemocht-Werden-Wollen-Virus.
Dieser mentale Virus ist gefährlich, denn er verhindert, dass das gesagt wird, was notwendig ist. Direkte sachliche Ansagen? Fehlanzeige. Konstruktive ehrliche Gespräche? Pustekuchen. Stattdessen wird der Klartext in kleine, unbedrohliche Wort-Wattebäusche verpackt. Sie tun garantiert nicht weh, doch bewirken tun sie leider auch nichts.
Meinung verschluckt?
Ich hatte beispielsweise solch einen Fall mit dem Vorstand eines börsennotierten Unternehmens. Es ging um die Umsetzungsbegleitung einer neuen unternehmerischen Strategie. In vielen Punkten waren wir uns bereits einig und einer Zusammenarbeit stand nichts mehr im Weg. Doch eine Voraussetzung wollte ich vorher noch klären. Deswegen fragte ich: „Damit wir die gewünschte Kulturveränderung erfolgreich umsetzen, werden wir auch heikle Themen offen und direkt ansprechen müssen. Sind Sie offen für eine solch offene Streitkultur?“ Für mich zwar nicht immer eine angenehme, aber dennoch eine selbstverständliche Normalität. Für mein Gegenüber jedoch nicht: „Grundsätzlich bin ich dafür. Aber nur, wenn das alles in einem loyalen Kontext stattfindet.“ Für mich war mit diesem Satz die Sache erledigt, denn offene Streitkultur funktioniert nur offen, und nicht unter Voraussetzungen und Filterungen.
Weichgespültes Verhalten begegnet mir jedoch nicht nur im Büro. Denken Sie an ein Restaurant. Der Kellner fragt: „Hat es Ihnen geschmeckt?“. Wie oft kommt jetzt ein „Ja“ , obwohl ein „Nein“ der Wahrheit entspräche. Oder in der Schule beim Elternabend. Die Eltern stehen unter sich und lästern über den Lehrer. Als dieser den Raum betritt, herrscht Schweigen. Am Ende der Veranstaltung fragt er: „Gibt es noch Fragen?“ – und keiner traut sich, den Mund aufzumachen. Stattdessen freundliches Lächeln ...
Die vergessene Sehnsucht
Dabei haben Menschen eine innere Sehnsucht nach klaren Worten. Mein meistgebuchter Vortrag ist „Heikle Botschaften – unter Druck souverän bleiben“. Nachvollziehbar, denn jeder weiß, heikle Botschaften sind Teil des Lebens, ob Sie wollen oder nicht. Das liegt an einem einfachen Kreislauf: Veränderungen führen zu Problemen. Diese müssen gelöst werden. Und die entstandenen Lösungen führen wiederum zu Veränderungen – und diese zu neuen Problemen. Es ist ein nicht aufzulösender Kreislauf. Im Gegenteil: Er dreht sich immer intensiver, da die Veränderungen nicht nur schneller und häufiger geschehen, sondern auch immer schärfer werden. Entsprechend nimmt die Zahl und Intensität der Probleme zu. Folge: Heikle Botschaften sind unvermeidlich.
Ja, aber sprechen wir solche Botschaften nicht schon an? Klar, auf Twitter, Facebook, YouTube und Co. reißt jeder in der Anonymität den Mund auf. Doch im Gespräch face to face bleibt er geschlossen. Es ist schon irgendwie merkwürdig, denn wir kommunizieren immer mehr, doch eine wirkliche Streitkultur und Meinungsfreiheit herrscht dadurch noch lange nicht. Viel zu oft sorgen dominante Macht-Typen dafür, dass ihr Umfeld „politisch korrekt“ mit ihnen spricht und der notwendige Klartext fehlt. Wahrheit will zwar jeder, nur hören irgendwie nicht. Doch die ist in meinen Augen unabdingbar, damit wir als Einzelner und auch als Gesellschaft wirkungsvoll leben.
Streiten? Ja, aber richtig!
Dazu brauchen wir zwei Dinge. Einerseits Streit, im Sinne von, dass Meinungsverschiedenheiten offen ausgetragen werden. Damit das nicht in Sodom und Gomorra endet, braucht es andererseits eine gewisse Kultur. Denn in unserer heutigen Gesellschaft ist Streit negativ belegt und hat nichts mit dem ursprünglichen, wertfreien Austausch zu tun.
Deswegen müssen wir als Gesellschaft wieder lernen, eine Streitkultur zu leben, in der wir Konflikte konstruktiv angehen. Damit sich nicht nur Dominanz durchsetzt, sondern auch zurückhaltende Menschen in eine Diskussion einbringen können. Damit das Wort nicht mehr im Wattebausch verpackt ist, sondern wieder zu einer Meinung wird. Damit alle Beteiligten sich für die Sache einsetzen, ihre Position vertreten können, sich gleichzeitig aber auch die der anderen anhören können. Wir sind nunmal keine wilden Tiere, sondern bezeichnen uns selbst als Krönung der Schöpfung. Und die sollte im 21. Jahrhundert soweit gekommen sein, eine konstruktive Streitkultur zu leben, um gemeinschaftlich zu einer sinnvollen Lösung zu kommen.
Streitkultur ist für mich die beste Medizin gegen das Gemocht-Werden-Wollen-Virus. Und mal so unter uns: Wenn Sie den Mut haben, in entscheidenden Situationen den Mund aufzumachen, gewinnen Sie bei mir Respekt. Und mit dieser Meinung stehe ich garantiert nicht alleine da.
Wenn der Wegweiser keinen Weg mehr weist
Davonrennen, alles hinter sich lassen und nochmal ganz von vorne starten. Wie oft haben Sie sich das schon einmal vorgestellt? Wenn es im Job überhaupt nicht mehr läuft. Oder jegliche Leidenschaft in der Beziehung verloren ging und Sie einfach nur noch wegwollen. Dann beherrscht Sie ein Gefühl: Hauptsache weg hier!
Keine Zeit zum Lesen? Dann einfach den Podcast hören:
Davonrennen, alles hinter sich lassen und nochmal ganz von vorne starten. Wie oft haben Sie sich das schon einmal vorgestellt? Wenn es im Job überhaupt nicht mehr läuft. Oder jegliche Leidenschaft in der Beziehung verloren ging und Sie einfach nur noch wegwollen. Dann beherrscht Sie ein Gefühl: Hauptsache weg hier!
Emotional macht das vielleicht Sinn. Doch nehmen wir mal etwas Abstand: wäre das Leben wirklich auf einmal besser, wenn Sie einfach abhauen und einen Neustart wagen?
Eine neue Liebe, ist wie ein neues Leben
Mit diesem Song-Titel hat Jürgen Marcus sowas von recht. Und aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass es auch für den Beruf gilt. Dieses Gefühl, wenn Sie endlich diesen Schritt, diesen Cut, wagen: es ist pure Euphorie. Als ich damals noch in der Finanzbranche arbeitete, war ich irgendwann richtig unzufrieden. Rund zwei Jahre notierte ich mir, was mich stört, was sich ändern muss. Manchmal nehme ich dieses Heft zur Hand und bin immer wieder fassungslos, dass ich mich zwei Jahre lang mit meiner Unzufriedenheit gequält habe, bis ich endlich eine Entscheidung traf: „Ich muss da raus.“
Die Entscheidung, endlich die Situation zu verlassen, fühlte sich fast an wie „frisch verliebt“. Ich spürte Euphorie. Zunächst jedenfalls …
Die Stille, die Sie erdrückt
Denn als ich keine Beschäftigung mehr hatte, war da einfach ... nichts mehr. Ich verlor meinen sinnvollen Horizont, meine berufliche Richtung. Ich hatte plötzlich kein Büro mehr, in das ich fahren konnte, keinen Terminkalender, der von anderen gefüllt wurde. Da war auf einmal nur noch Stille.
Aus heutiger Sicht weiß ich: Wegrennen bringt Sie nicht weiter, wenn Sie keine Ahnung haben, wohin Sie eigentlich rennen wollen.
Die Hoffnung stirbt zuerst
Verstehen Sie mich bitte richtig: wenn im Leben etwas ganz gravierend schiefläuft und Sie so Ihre persönliche Integrität verletzen, ist es in meinen Augen jedermanns Pflicht, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und etwas zu ändern. Lebenszeit ist schließlich begrenzt – auch für mich, wie mir meine Tumorerkrankung am eigenen Leib deutlich gemacht hat.
Der Moment, in dem Sie also einen quälenden Job, eine nicht-erfüllende Beziehung oder ein sinnloses Projekt beenden, ist ohne Frage sinnvoll. Doch die Hoffnung, dass mit diesem Ende automatisch alles gut sein wird, verfliegt schnell. Denn eine falsche Richtung aufzugeben, bedeutet eben auch, genau wissen zu müssen, wo die neue Richtung hin verlaufen soll. Eine banale Erkenntnis, mit der ich damals nicht gerechnet habe.
Der kaputte Wegweiser
Ich stand damals plötzlich vor meinem inneren Wegweiser und hatte keinen blassen Schimmer mehr, wo ich nun hinlaufen sollte. Er zeigte mir keinen Weg an. Unweigerlich war es dann an der Zeit, mir endlich die entscheidenden Fragen zu stellen. Ich konnte mich nicht mehr vor mir selbst verstecken, wenn ich wieder eine Richtung haben wollte. Die Entscheidung „weg von etwas“ fällt eben leicht, ist aber leider nur die Hälfte der Miete. Viel entscheidender ist die Antwort auf die Frage: „hin zu was denn?“.
Was kann ich richtig gut? Womit kann ich anderen einen Nutzen stiften? Worin will ich der Beste werden, weil ich darauf einfach Lust habe? Bei mir kristallisierte sich nach und nach ein klares Bild heraus. Ich wollte mich nicht mehr verbiegen, merkwürdige Kompromisse machen oder mich mit den „falschen“ Themen und Menschen beschäftigen. Während meiner Zeit in der Finanzbranche hatte ich erlebt, wie kräftezehrend es ist, wenn man genau das alles falsch macht. Ich spielte jahrelang nach Regeln, die nicht meinen Werten entsprachen. Das wollte ich nicht mehr. Ich wollte etwas Sinnvolles tun. Etwas, mit dem ich für andere einen Nutzen stiften konnte.
Ich hatte so viele Menschen im Berufsleben kennengelernt, die in einem finanziellen Käfig gefangen waren: erfolgreich, aber unglücklich. Es geht nicht darum, glücklich oder finanziell erfolgreich zu sein. Die Kunst ist, beides zu erreichen. Und so bin ich heute dankbar, Menschen dabei zu helfen, einen sinnvollen Weg, eine neue Richtung für sich zu finden. Wirkungsvoll zu werden und Ergebnisse zu erzielen, für die es sich lohnt, sich anzustrengen. So wie ich es damals machen musste.
Und diese neue Richtung zu haben, war alle Mühe wert!
Weil Ihr Bett ein Gedächtnis hat
Wo haben Sie geheiratet? Wo waren Sie am 11. September? Wo feierten Sie einen großen Projekterfolg – oder bekamen eine Standpauke von Ihrem Chef? Ich bin mir sicher, Sie haben schlagartig die Bilder zu einer dieser Situationen vor Augen. Denn: Manche Dinge bleiben ewig im Gedächtnis. Und vor allem der Ort, an dem sie stattgefunden haben.
Weil Ihr Bett ein Gedächtnis hat
Wo haben Sie geheiratet? Wo waren Sie am 11. September? Wo feierten Sie einen großen Projekterfolg – oder bekamen eine Standpauke von Ihrem Chef? Wo fand Ihr erster Kuss statt?
Ich bin mir sicher, Sie haben schlagartig die Bilder zu einer dieser Situationen vor Augen. Denn: Manche Dinge bleiben ewig im Gedächtnis. Und vor allem der Ort, an dem sie stattgefunden haben.
(K)ein Ort für heikle Familienthemen
Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber bei uns zuhause ist er Esstisch einer der wenigen Orte, an dem wir uns als Familie regelmäßig und vollständig treffen. Und genau deswegen ist der Esstisch eine Art „heiliger“ Ort für mich. Heilig im doppelten Sinne: Hier haben Smartphones oder andere Dinge, die ablenken, beim Essen nichts zu suchen. Und: Hier diskutieren wir keine heiklen Themen.
Natürlich ist es irgendwie praktisch, wenn doch schon alle beim Abendessen zusammensitzen, gleich auch die Fünf in Mathe oder die vulgäre Ausdrucksweise des Teenagers zu thematisieren. Schlechte Noten und sonstige Vergehen haben am Esstisch jedoch nichts zu suchen. Sonst brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn die Teenager irgendwann ihre Teller nehmen und zum Essen lieber in ihr Zimmer verschwinden.
Ein befreundeter Geschäftsführer beherzigte den Gedanken und erzählte mir: „Für solche Gespräche zitiere ich meinen Sohn nun immer aufs Sofa. Vielleicht ist das der Grund, warum er seit Neustem vom Sessel aus Fernsehen schaut …“
Überraschungsangriff im Büro
Vielleicht scheint das private Esstisch-Thema für Sie übertrieben. Doch stellen Sie sich nun bitte eine Situation aus Ihrem Arbeitsalltag vor: Ihr Chef platzt unangekündigt in Ihr Büro und macht Sie rund. Oder er ruft Sie in sein Büro und kritisiert Sie dort aufs Schärfste oder bespricht mit Ihnen ein heikles Thema im Meetingraum. Was glauben Sie, wie Sie sich fühlen, wenn Ihr Chef das nächste Mal in Ihr Büro kommt, Sie zu sich ruft oder Sie in den Meetingraum bestellt?
Ob bewusst oder unbewusst, Sie rufen sich die alten Erlebnisse ins Gedächtnis und befürchten automatisch, dass es jetzt wieder Ärger geben könnte. Das verursacht Stress. Die Orte haben ein Gedächtnis und durch dieses Verhalten Ihres Chefs ist Ihr Büro auf einmal ein negativ behafteter Ort geworden. Dabei soll es doch ein kreativer Raum sein, in dem Sie gerne arbeiten und gute Leistung bringen.
Deshalb verkünde ich heikle Botschaften immer an einem Ort, an dem sich meine Mitarbeiter nicht regelmäßig aufhalten. Meist wähle ich den Besprechungsraum. Damit sie wissen, worum es geht, kündige ich das Thema vorher an. Denn wer seine Mitarbeiter im Dunkeln lässt, missbraucht unnötig seine Macht. Doch meine Mitarbeiter sollen keine Angst haben, sondern sich sicher fühlen, um ihr volles Potenzial zu entfalten.
Die Regeln des Ehebetts
Ich möchte nicht, dass meine heiligen Orte negativ belegt werden und ich möchte auch nicht die positiven Orte anderer Menschen mit einem schlechten Erlebnis belasten. Meine Frau und ich haben zuhause deswegen einen zweiten „heiligen“ Ort definiert: unser Ehebett. Es ist ausdrücklich nur für Dinge gedacht, die Spaß machen oder der Erholung dienen :-)
Früher gab es in den Ehen den sogenannten „Pillow-Talk“ (engl. pillow = Kissen): Vor dem Schlafen sprachen Mann und Frau über den Tag. Dieses Gespräch wurde zunehmend ersetzt durch Fernseher, Laptops und Smartphones. Doch eine Ehe braucht Austausch. Zwar haben wir keinen Fernseher im Schlafzimmer, aber Laptop und Smartphone haben auch bei uns Einzug erhalten. Um das Ehebett trotzdem heilig zu halten, berücksichtigen meine Frau und ich zwei Regeln:
Im Bett werden keine kritischen Themen besprochen – auch wenn es manchmal schwerfällt. Zweitens: Egal, was wir tun – wir beenden jeden Tag, indem wir abends im Bett gemeinsam den Satz „Gott schütze unsere Ehe“ sagen. Das machen wir sogar, wenn ich auf Reisen bin, dann eben via Telefon.
Rituale festigen
Sie können mich jetzt als zu weich oder als unverbesserlichen Romantiker abstempeln. Ich möchte mich auch gar nicht als Bilderbuch-Ehemann darstellen. Aber ich kümmere mich jeden Tag intensiv um meine Kunden -- und mir fällt bei bestem Willen kein Grund ein, warum ich mich nicht auch jeden Tag intensiv um meine Ehe kümmern sollte. Deshalb halte ich es auch für richtig, dafür zu sorgen, dass meiner Frau und mir positive Orte im Gedächtnis bleiben.
So besuche ich an jedem Hochzeitstag mit meiner Frau den Ort unserer Trauung und ich wiederhole meine Frage: „Willst Du meine Frau sein?“ Sie sagte mir anfangs, dass sie das eigentlich nicht braucht – aber es gefällt ihr. Und so geben wir uns durch Rituale Kraft und fokussieren unsere Aufmerksamkeit auf das, was uns wirklich wichtig ist – an unseren heiligen Orten.
Welche Orte sind Ihre heiligen Orte? Vielleicht achten Sie in Zukunft mehr darauf, wie Sie sich dort verhalten …
Kampf dem Weichspüler im Büro
In Büros verbreiten sich Yoga-Kurse in der Mittagspause, 360-Grad-Feedbacks und Wohlfühlatmosphäre – aber was passiert, wenn die Ergebnisse auf einmal nicht mehr stimmen?
In Büros verbreiten sich Yoga-Kurse in der Mittagspause, 360-Grad-Feedbacks und Wohlfühlatmosphäre – aber was passiert, wenn die Ergebnisse auf einmal nicht mehr stimmen?
In meinem Beitrag bei Redaktion Die Ratgeber lade ich Sie ein zum „Kampf gegen den Weichspüler im Büro“.
WORUM ES GEHT
Lassen Sie uns das Stärkste unternehmen, was uns möglich ist: Gegenwart machen. Um beruflich wie privat wirkungsvoll zu sein und ein erfülltes Leben zu führen. Im Blog finden Sie dazu geistige Reibungsfläche. Viel Freude beim Lesen.
THEMEN
BÜCHER
DIGITALE FORTBILDUNG
Umsetzungs-orientierte Online-Trainings stehen Ihnen rund um die Uhr zur Seite, damit Sie wirkungsvoller werden.